3 Hl THEOLOGEN | BEGEGNUNG | Orthodoxes Totengedenken ||| Vorbereitende Sonntage | Vorfastenzeit |
|
zurueck zur Einstiegseite / zum Auswahlmenue ueber alle Seiten der Orthodoxen Fraternitaet in Deutschland
"Fastenregeln" / FASTEN / Fasten ? nach dem Hl. JOHANNES (Chrisostomos)
GEBET des Hl. EPHRAIM des SYRERS / Kanon der Umkehr unseres Vaters unter den Heiligen ANDREAS von KRETA
Fasten-Hirtenbrief 2007 des Oekumen. Patriarchen BARTHOLOMAIOS: "...Zeit der Geistlichen Kaempfe"
Fasten-Hirtenbrief 2004 des Oekumen. Patriarchen BARTHOLOMAIOS: „Öffne mir, Lebensspender, das Tor zur Umkehr!“
Fasten-Hirtenbrief 2004 der Orthodoxen Bischoefe Deutschlands
Beten und Fasten - Erzbischof STYLIANOS von Australien
» ... sondern nur durch Beten und Fasten« (Erzpr. Prof. Alexander Schmemann (+ 1983)
Metropolit MARK zu FASTEN, GEBET und orthodoxen GLAUBEN (zusammengestellt von UOJ 2026)
"Die Tueren zur Umkehr, oeffne mir, Lebensspender ! ..."
~~~
Komponist: Artemij WEDEL /// Interpretation: F.TSCHALJAPIN mit Chor der
Russischen Orthodoxen Kathedrale Paris 1932 ~~~
zur Link-Quelle: "http://www.musicarussica.com"
https://youtu.be/3XezKT4qqN0?si=vVEllt8ZogNW3uPD
https://youtu.be/KfBZPIiOLec?si=Wsu8CjFjQYI_cQjs
AUFERSTEHUNGS - Nacht
11./12.4. 2026
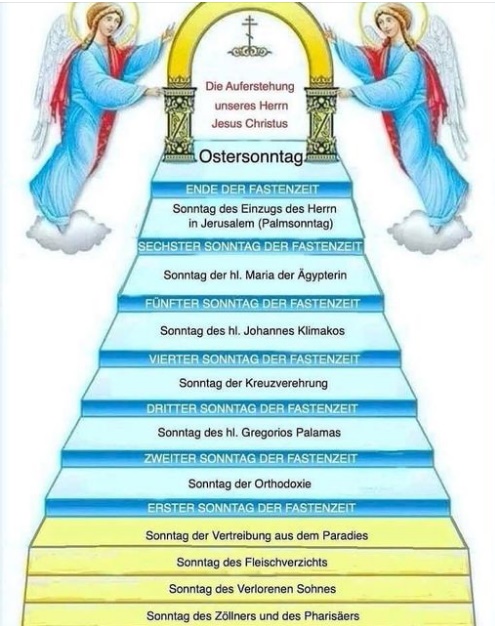
"Die
Tueren zur Umkehr, oeffne mir, Lebensspender ! ..."
~~~
Komponist: Artemij WEDEL /// Interpretation: F.TSCHALJAPIN mit Chor der
Russischen Orthodoxen Kathedrale Paris 1932 ~~~
zur Link-Quelle: "http://www.musicarussica.com"
22.2.
2026
Sonntag vom VERLUST
des PARADIESES
VERGEBUNGSSONNTAG !
BUTTERENTSAGUNG !
- am Abend des
Sonntags:
BEGINN der GROSSEN 40-taegigen FASTEN
"Über die
Vergebung"
von Erzbischof Antonij von Surozh (London)
Apostel:
Rm 13:11 - 14:4
Evangelium: Mt 6: 14 - 21
Das
Evangelium dieses Sonntags, an dessen Abend die Grossen Fasten
beginnen, erinnert uns daran, dass wir Vergebung vom Herrn erst
erwarten können, wenn wir nicht selbst bereit sind, unseren
Mitmenschen zu vergeben, was sie uns an Verletzung zugefügt
haben - und sie unsererseits um Vergebung zu bitten für das,
was wir bewusst oder unbewusst an ihnen gefehlt haben.
Darum findet an diesem Sonntagabend nach der Vesper in die Handlung des
Gegenseitigen Vergebens statt, wie sie am Schluss des Apodipnons in
Klöstern täglich geübt wird. In manchen
Kirchen wird
dieser Ritus aus praktischen Gründen unmittelbar nach der
Liturgie
ausgeführt. In den Häusern ist die Vergebung als
Abschluss
der Karnevals- und Butterwoche mit einem Fest vor allem für
die
Kinder verbunden, dabei werden zum letzten Mal die Milch- und
Butterspeisen genossen.
Die folgende Woche ist ganz dem intensiven
Fasten gewidmet. Es beginnt die fortlaufende Lesung aus dem
Buch Genesis, die im Sündenfall und dessen Folgen
mündet. Mit dem Verlust des uns von Gott bereiteten Paradieses
durch unsere selbstzerstörerischen Abwege beginnt auch die
Sehnsucht nach dem Ende der widernatürlichen Sünden
und dem neuen Paradies. Die dafür erforderliche Bereitschaft
zur Umkehr wird in der kommenden Woche durch das Gebet des heilsamen Busskanons des
Hl.Andreas von Kreta
gefördert. Wir fühlen mit, dass wir mit unseren
Sünden nicht allein sind, aber werden auch dazu ermutigt, uns
den Figuren des Bibel anzuschliessen, die den Mut fanden, Gott um
Vergebung zu bitten, und Ihm damit wieder nahe zu kommen.
Trotz -und vielleicht wegen- all unserer negativen Erfahrungen ruft uns
die Apostellesung zu:
"
Jetzt ist unser Heil näher als damals, da wir gläubig
wurden.
Die Nacht ist vorgerückt, der Tag hat sich genaht "
(Rm 13:11 ff)
Für die Fastenzeit wird uns mitgegeben:
"
Wer isst, soll den nicht verachten, der nicht isst;
und wer nicht isst, soll den nicht richten, der isst;
denn Gott hat ihn angenommen.
Wer bist du denn, dass du einen fremden Knecht richtest ?
Seinem eigenen Herrn steht oder fällt er - aber er wird
stehen; denn der Herr hat die Macht, ihn aufrecht zu erhalten "
(Rm 14: 3-4)
Führer auf dem Weg
der Weisheit,
Urgrund des Verstandes,
Lenker der Unverständigen
und Beschützer der Armen,
festige, unterweise mein Herz, Gebieter.
Gib mir das Wort, Du Wort des Vaters !
Denn, siehe, nicht lassen ab
meine Lippen zu Dir zu schreien:
Barmherziger,
erbarme Dich meiner,
des Gefallenen !
(Kondakion)
Über die
Vergebung
zum Sonntag der Vergebung
von Erzbischof Antonij von Surozh (London)
Wenn mir jemand ein Unrecht zugefügt hat, das ich vergebe und vergesse, dann sind wir beide in Gefahr, dass das gleiche sich wiederholt, denn einerseits entsteht und vergeht diese Verzeihung auf der Stelle: sie ist nichts Beständiges und auf die Zukunft hin Ausgerichtetes.
Etwas Vergangenes ist an eine Grenze gelangt, die es nicht überschreitet;
die Zukunft ist ohne Erfahrung aus der Vergangenheit.
Andererseits, wenn ich vergesse, vergesse ich zweierlei: wohl vergesse ich das Unrecht, das mir angetan wurde, gleichzeitig aber auch den Grund, aus dem es mir zugefügt wurde, und ich kann den Betreffenden niemals vor der Versuchung bewahren, in die gleiche Situation zurückzuverfallen.
Man
muss sich erinnern, dass dieser Mitmensch, sobald er in jene
bestimmte Lage versetzt wird, diese bestimmte Schwierigkeit hat;
folglich darf man ihn nicht wieder in dieselbe Lage bringen;
man muss die zurückbleibende Schwäche erkennen.
Darum ist es so wichtig, sich zu erinnern, denn das ist die einzige
Möglichkeit das Verzeihen fortzusetzen.
„Ich habe dir deine ungeduldige Handlung verziehen, aber ich
habe
dadurch entdeckt, dass diese bestimmte äußerung,
jene Geste,
diese besondere Situation sie hervorrufen können.“
Es gilt, den andern vor diesen Situationen zu bewahren, solange, bis
man ihm geholfen hat die notwendige Kraft zu gewinnen, die Spannung zu
überwinden. Andernfalls stoßen wir unsere
Mitmenschen
ständig neu in Situationen hinein, wo sie unfehlbar auf die
gleiche Weise reagieren werden, wie sie das Problem hervorrief.
Außerdem
ist das Verzeihen eine besondere Weise, einen anderen
Menschen anzunehmen.
Das beginnt in dem Augenblick in dem man sagt: „Ich nehme
dich
an, so wie du bist. So wie du bist trage ich dich, wie man ein Kind
über eine schwierige Stelle hinwegträgt oder wie man
ein
Kreuz trägt, aber ich weise dich nicht zurück. Zu
sagen, dass ich dich annehme, so wie du bist, heißt
keineswegs, dass du bist wie du sein solltest.“
Nur
wenn man einen Menschen so annimmt, wie er ist, kann man ihm helfen
sich zu ändern.
Aber man darf nicht zuerst fordern, er müsse sich
ändern, um ihm zu versprechen, hernach werde man ihn lieben.
Im Russischen sagt man: „Liebe mich schwarz ! Wenn ich erst
weiß bin, werden alle mich lieben.“
Es gibt nur Probleme wo der Mensch sie schafft. Ein Mensch aber, der
Probleme schafft, muss so sehr geliebt werden, dass er im Vertrauen den
Glauben an sich selber wiederfinden kann, die Selbstachtung und jene
schöpferische Hoffnung, die ihm ermöglichen wird,
sich zu ändern.
Folglich
übernimmt man mit dem Verzeihen die Verantwortung für
einen Menschen, so wie er ist, mit der Hoffnung auf die Zukunft, jedoch
ohne Bedingungen zu stellen!
Man verzeiht nicht unter Bedingungen. Es geht nicht an, einem Menschen
„mit Bewährungsfrist“ zu verzeihen. Das
zeigt sich sehr deutlich im Gleichnis vom Verlorenen Sohn.
Der Vater fordert nichts; ihm genügt es, den Sohn
wiedergekehrt zu
sehen, um zu wissen, dass er die Umkehr vollzogen hat, dass er
verändert zurückqekehrt ist. Verändert
bedeutet ganz und
gar nicht vollkommen. Er mag sich verändert haben und dennoch
für eine lange Zeit für die Familie schwer
erträglich
geworden sein. Dem Vater genügt es, dass sein Sohn
wiedergekehrt
ist; was noch zu tun bleibt, kann man gemeinsam überwinden.
Das
Verzeihen enthält vielerlei Elemente.
Zuerst muss einer kommen und um Verzeihung bitten oder doch wenigstens
einen Schritt in diese Richtung tun;
es ist nicht schwer, zu verzeihen, wenn man glaubt, im Recht zu sein;
es ist auch nicht schwer, einen Schritt entgegen zu kommen, wenn man im
Recht ist oder sich im Recht wähnt.
Darum muss derjenige, der im Recht zu sein glaubt, den ersten
Schritt tun.
Eine Gebärde, ein unmerklicher Hinweis, dass eine
Aussöhnung
erwünscht wäre, muss genügen, diesen Schritt
zwingend zu
machen.
Dann aber muss ein solcher Versuch zur Versöhnung
bedingungslos angenommen werden, denn ein Mensch kann sich
nur ändern im Maße der Hoffnung, die wir in ihn
setzen, im Maße der Liebe, die wir ihm zu geben
vermögen und im Maß unseres Glaubens an ihn
.
In
einer Gemeinschaft stellt sich das Problem anders.
Die Tatsache, dass ein Mensch Mitglied einer Gemeinschaft ist, kann ein
Problem bedeuten, nicht nur für einen Einzelnen, sondern
für eine ganze Gemeinschaft. Dann muss die Gemeinschaft zu der
zugleich kranken und heilenden Gemeinschaft der Kirche werden: krank,
weil jeder von uns ein Sünder ist und wir alle eine zutiefst
beschädigte Gemeinschaft sind; dennoch aber auch eine
Gemeinschaft, die fähig ist Gesundheit zu vermitteln, zu
heilen, das ewige Leben mitzuteilen. Denn
keine christliche
Gemeinschaft besteht nur aus ihren sichtbaren
Gliedern: Christus ist in ihrer Mitte, der Heilige Geist ist ihr
gegeben, und ob es die Kirche in ihrer Gesamtheit oder eine kleine
Kirchengemeinde ist – in der Gemeinschaft sind Gott und
Mensch
gänzlich für einander gegenwärtig, und wir
können
in Gott die Kraft finden, die wir als Menschen nicht besitzen.
Die Erfahrung, geliebt zu werden in vollem Bewusstsein dessen wie wir sind
– nicht trotzdem, oder weil man nicht wüsste, wie wir sind – ist ein sehr herrliches Geschenk, das Anlass zu Dankbarkeit und Demut wird und das aus unserem Leben ein demütiges Voranschreiten im Gebet macht.
Doch muss die Verzeihung auch angenommen werden.
Oft meinen Menschen, keine Verzeihung annehmen zu können, weil sie sich selber nicht verzeihen können. Selber können wir uns nicht verzeihen, aber wir müssen von einem anderen Menschen die Verzeihung annehmen können, – mag vorgefallen sein was will – dass er uns zugetan bleibt; was eine wahrhaft unverdiente Gnade ist. Und das ist schwer.
Viele Menschen vermögen auch in der Absolution Gottes Verzeihung nicht anzunehmen und können nicht absolviert werden. Gott hat verziehen – aber sie haben die Absolution trotzdem nicht erhalten.
Es ist auch schwer, die Verzeihung unverdient anzunehmen.
Es kann demütigend sein. Aber wenn wir besser verstehen lernen, wenn wir zu geben lernen, lernen wir auch zu empfangen. Einer, der sich selbst nicht verzeihen lassen kann, vermag auch selbst niemals zu vergeben. Einer, der nicht annehmen kann, geliebt zu werden, anerkannt zu werden, Hingabe zu empfangen, kann auch seinerseits nicht lieben, anerkennen, Hingabe aufbringen, denn derlei geschieht wechselseitig. Unverdient zu empfangen lernt man in staunender Freude, Demut und Dankbarkeit, mit der wir eine unverdiente Gabe beantworten. Und haben wir das erst entdeckt, können auch wir zu schenken beginnen ohne uns darum dem Empfangenden gegenüber überlegen zu fühlen.
Natürlich
ist unser Verzeihen nicht Gottes Verzeihen.
Doch müssten wir lange warten, bis wir so zu verzeihen
vermöchten. Aber wir können damit beginnen zu lernen,
uns gegenseitig in all unserer Begrenztheit anzunehmen. Es ist schwer,
um Verzeihung zu bitten, es ist auch nicht leicht, zu verzeihen, doch
Verzeihung zu verweigern ist ebenfalls schwer.
Am
Sonntag vor der Großen
Fastenzeit, nach dem Verzeihungsgottesdienst, der ein Gottesdienst der
Buße und der Hoffnung ist, sollen alle Glieder einer
Gemeinschaft
einander um Verzeihung bitten.
Jahrelang habe ich die Leute ermuntert, einander zu
vergeben;
dann habe ich beobachtet, wie sie mit Wärme und Enthusiasmus
Leute um Verzeihung baten, die sie niemals beleidigt hatten;
aber sie bewiesen sehr viel mehr Zurückhaltung bei anderen,
von denen sie selber Verzeihung zu erhoffen hatten;
und schließlich sah ich sie denen den Rücken kehren,
die keinerlei Bedürfnis hatten ihnen zu verzeihen, weil sie
sich ihnen gegenüber tatsächlich allzu rüde
verhalten hatten.
– Da habe ich zunächst verlangt, dass niemand
Verzeihung von
jemand erbitten sollte, den er nicht darum bitten wollte,
– weil er noch zu keinem Frieden mit ihm gefunden hatte.
Dann sollten sie sagen: „ich bitte Sie nicht um Verzeihung,
weil
meine Einstellung sich noch nicht geändert hat. Wenn Sie mir
verzeihen ändert das nichts; ich verabscheue Sie und habe die
Absicht, Sie auch weiterhin zu verabscheuen.“
Und von denen, deren Verzeihung man erbat, die sie nicht
gewähren konnten dass sie antworten sollten:
„Ich bin sehr bekümmert, aber mein Herz ist noch zu
schwer,
ich bin noch zu bitter, ich kann Ihnen noch nicht verzeihen.“
Dann
aber wurden beide Parteien aufgefordert, sich in der Beichte vor Gott
hinzustellen und ihm zu sagen:
„Herr, ich erwarte von Dir jetzt Vergebung. Selber Vergebung
zu
gewähren, verweigere ich. Ich erwarte einen Schritt auf mich
zu,
lehne es aber selbst ab diesen Schritt zu tun .....“ Jemandem
zu
sagen, „Ich lehne es ab, zu verzeihen,“ wirkt so
erschütternd, dass die Menschen zu denken beginnen. Gesagt zu
bekommen, „ich kann dir nicht mit Überzeugung
vergeben“ ist ebenfalls erschütternd.
Wenn
in einer Gemeinschaft der Mut aufgebracht wird, wenigstens so
aufrichtig zu sein, dass man es fertig bringt, zu sagen: „Ich
bin nicht imstande dir zu verzeihen;
das heißt nicht, dass du so schlimm bist, dass ich dir nicht
verzeihen könnte, sondern, dass ich so schlimm bin, es nicht
fertig zu bringen, dir zu verzeihen“, dann wird derjenige,
der nicht verzeiht, Gegenstand der Sorge und der Fürbitte der
Gemeinschaft, mehr als der andere, dem die Verzeihung verweigert wird
– solange, bis er Verzeihung erbitten kann.
Wenn
uns ein Mensch begegnet, so ist das niemals ein zufälliges
Zusammentreffen.
Dieser Mensch muss in unserer Gegenwart, unserm Blick, der Art, wie wir
ihn behandeln, der Art, wie wir auf der Straße an ihm
vorübergehen, eine Gottesgegenwart, lebendiges Gebet
spüren.
Jemand kommt, stets ist er mir ein Gesandter des Herrn: ob er mit einer
Botschaft kommt oder mit ausgestreckter Hand – wir sind
aufgerufen, eine Liebestat zu tun, eine Tat christlicher Liebe.
Jeder
Umstand, dem wir im Leben begegnen, ist gottgewollt, wir sollen in die
Situation eintreten und Gott gegenwärtig machen durch unsere
Gegenwart und unser Gebet. Ob ein Leben erfolgreich ist oder nicht
macht wenig aus im Hinblick auf das Gebet.
Was auch kommen möge, vor jeder neuen Situation
können wir bitten:
Herr, gib mir Einsicht,
gib mir ein Herz, das fähig ist, zu antworten,
gibt mir den rechten Willen,
sei gegenwärtig in dem was hier geschieht.
Wenn ein anderer spricht, können wir ständig beten und den Herrn bitten, uns verstehen zu lehren, nicht nur die Worte, die ausgesprochen werden, sondern das tiefe Bedürfen, die Wirklichkeit, die sich hinter den Worten oftmals verbirgt. Und wenn die Zeit gekommen ist und der andere nicht mehr spricht, kann man so lange schweigen und beten, bis man etwas zu sagen weiß; und wenn einem dann ein Gedanke gekommen ist, der die Klarheit und Gewissheit der Dinge hat, die von Gott kommen, – dann können wir ihn vorbringen und hernach Gott bitten, er möchte für den anderen Menschen bewirken, was wir nicht zu bewirken vermögen, er möchte, wenn wir einen Irrtum begingen, ihn uns verzeihen und ihn heilen, und wenn der Mensch gegangen ist, weiter für ihn beten.
Die
Art, wie man eine Frage stellt,
die Art, wie man zuhört, wie man eine Entfaltung
möglich oder
unmöglich macht, ist so wesentlich.
Einen Menschen, der nichts zu antworten weiß und sich
schämt, – mit dem Gefühl
zurückzuschicken,
völlig versagt zu haben
- oder doch mit ein wenig Hoffnung und der Freude, jedenfalls als
Mensch angenommen worden zu sein.
Alles
kann im Gebet verankert sein.
Man kann lernen, sich der Gegenwart Gottes ständig bewusst zu
werden, mit einem klaren, lebendigen Gefühl, ihm zugewandt
bleiben; jedoch immer mit voller Aufmerksamkeit; denn es ist vielfach
Unaufmerksamkeit, die nach und nach die Wirklichkeit aller Dinge
zerstört...
Übersetzung
aus dem Englischen: Irene Hoening
hier aus St. Andreas Bote
Vollständiges Fasten, wie in den Grossen 40-tägigen Fasten vor dem Auferstehungsfest vorgesehen, bedeutet Abstinenz von Fleisch, Eiern, allen Milchprodukten, Fisch, Wein und Öl. Der Speiseplan besteht also praktisch nur aus Gemüse, das ohne Öl zubereitet wird, Kartoffeln, Reis und Brot, wobei den Hülsenfrüchten (Erbsen, Bohnen jeder Art, Linsen) besondere Bedeutung zur ausgewogenen Ernährung zukommt. An den Samstagen und Sonntagen dieser Fastenzeit ist laut Typikon zusätzlich Wein und Öl erlaubt, was die Zubereitung der Speisen erleichtert. An einem besonderen Feiertag, wie zum Fest der Verkündigung an die Gottesmutters am 25. März (7.4.) aber z.B. nicht am Sonntag der Orthodoxie ! sind auch Fischspeisen erlaubt.
Dabei ist jedoch immer zu bedenken, dass die Fasten keine Zwangsjacke darstellen, sondern eine Hilfe, die die Abhängigkeiten aufheben und uns auf das Gebet hin orientieren sollen.
Dadurch gehört auch weitestgehender Verzicht auf "Zeitvertreib" und Unterhaltungsmedien.
Ernsthafte Bemühungen in der Überwindung persönlicher Schwächen sind notwendige Begleiter sinnvollen Fastens.
Hingegen sollte bei gesundheitlichen Problemen wirklich nur Überflüssiges dem Fasten unterworfen werden.
Damit hier keine Willkür oder unheilsame Unsicherheit aufkommt, sollte man sich immer mit dem "Geistlichen Vater", zu dem ein jeder Christ für seinen Nächsten werden kann, absprechen !
F A S T E N
Jes 58: 4 ff
+++
Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr
und schlagt mit gottloser Faust drein.
Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr es jetzt tut,
wenn eure Stimme im Himmel gehört werden soll.
Das aber ist ein Fasten, an dem ich Gefallen habe:
Loese die Fesseln derer, die du mit Unrecht gebunden hast;
Loese die Stricke des Jochs !...
Teile mit den Hungrigen dein Brot,
und die im Elend ohne Obdach sind, fuehre in dein Haus...
Dann wird dein Licht hervorleuchten wie die Morgenroete,
und dein Heil wird schnell voranschreiten,
und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen,
und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschliessen.
Dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten.
Wenn du schreist, wird ER sagen:
Siehe, hier bin ich !
Wenn du bei dir niemanden unterjochst
und nicht mit Fingern zeigst
und nicht uebel redest,
sondern den Hungrigen dein Herz finden laesst
und den Elenden seinen Mangel linderst,
dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis
und dein Dunkel wird sein wie der Mittag.
Und der Herr wird dich immerdar fuehren
und dich satt werden lassen in der Duerre
und dein Gebein staerken.
Und du wirst sein
wie ein gut bewaesserter Garten
und wie eine Wasserquelle,
der es nie an Wasser fehlt.
+++
So singen wir am Beginn der Fasten:
+++
Lasset uns ein Fasten halten,
welches dem Herrn gebuehrt und wohlgefaellig ist:
Entfremdung von boesen Taten,
Beherrschung der Zunge,
Enthaltung von Zorn,
Fernhalten von zwanghafter Begierde,
Verleumdung,
Luege und
Meineid.
Die Freiheit von diesen Dingen
ist ein wahres Fasten.
+++
Beweise es durch deine Werke:
Wenn du einen armen Menschen siehst, habe Mitleid mit ihm.
Wenn du siehst, dass ein Freund geehrt wird, dann beneide ihn nicht.
Lass nicht nur deinen Mund fasten, sondern auch das Auge und das Ohr und die Füße und die Hände und alle Glieder des Körpers.
Die Hände sollen fasten, indem sie frei von Gier sind.
Lass die Füße fasten, indem sie aufhören, der Sünde hinterherzulaufen.
Die Augen fasten, indem sie lernen, nicht auf das zu blicken, was sündig ist.
Das Ohr soll fasten, indem es nicht auf böses Gerede und Klatsch hört.
Der Mund soll fasten, indem er sich von bösen Worten und ungerechter Kritik fernhält.
Denn was nützt es, wenn wir uns vom Essen von Hühnern und Fischen fernhalten,
aber unsere Brüder beißen und verschlingen?
Hl. JOHANNES, der Mund Goldener Worte (Chrysostomus)
Warum wir fasten ?
Prof. Dr. John Breck
Charleston,USA - Paris,St.Serge
übersetzt von G. Wolf
St.Andreas-Bote
Viele
Christen haben
die überkommene Fastenpraxis aufgegeben.
In vielen heutigen westlichen Kirchengemeinschaften scheint sie
mühsam und unwesentlich.
Für diejenigen aber, die die heilende (eschatologische) und
heiligende (sakramentale) Bedeutung des Fastens schätzen, ist
es so wesentlich wie Essen und Trinken.
Warum fasten also die orthodoxen Christen ?
Für die meisten ist das Leben schon herausfordernd genug
ohne selbstauferlegte Schranken für das, was wir an gewissen
Wochentagen und während langer Perioden des Kirchenjahres
essen,
trinken und tun.
Sorgt sich Gott wirklich darum ob wir freitags Fleisch essen oder den
Kühlschrank während der Fastenzeit von Milchprodukten
befreien ?
Ist das wirklich wichtig ?
Zusätzlich haben manche noch Bedenken wegen der
Scheinheiligkeit, die das Fasten manchmal begleitet.
Wir weigern uns aus spirituellen Gründen manche Lebensmittel
zu essen,
tun aber wenig oder gar nichts dafür, unser Verhalten
gegenüber Anderen zu ändern.
Eine mit der Fastenzeit verbundene Klage (sowohl vom Hl. BASILIOS dem
Grossen,
wie vom Hl. CHRYSOSTOMOS überliefert und von Metropolit Simeon
von
der Bulgarischen Orthodoxen Kirche auch in unserer Zeit wiederholt
gelehrt,
Anm. des Herausgebers dieser Internet-Seite) fasst das mit
erschreckender Genauigkeit zusammen:
" DU ENTHÄLTST DICH DER FLEISCHSPEISE - ABER DU VERSCHLINGST
DEINE NÄCHSTEN !"
Der Hl.JOHANNES vom Sinai hat uns die wirkliche spirituelle Gefahr
aufgezeigt, die im übermässigen Genuss liegt:
...Essen soll den Körper gesund erhalten;
aber nicht durch un-überlegte -oft von aussen
suggerierte- Wünsche
versklaven und
uns von der Sorge um unser Heil ablenken !
Die pastoralen Erfahrungen der Kirchenväter ergänzen
die biblischen Mahnungen, wie die des Hl. Apostels PAULUS:
" ... sorgt nicht so für euren Leib, dass unsinnige Begierden
erwachen " (Röm. 13,14).
Die asketische Tradition der Alten Kirche kennt mehrere Gründe
für das Fasten.
Richtiges Fasten reinigt den Körper von Giften, es erleichtert
das Gebet,
es hilft LEIDENschaften und Versuchungen zu beherrschen,
und es hilft Solidarität mit den Armen dieser Welt zu
fühlen.
Diese Tradition aber besteht auf einem Zugang zum Fasten, der heute oft
vergessen wird:
Ausgewogenheit und Masshalten.
Wir können uns zwanghaftes "Etikettenlesen" von allen
gekauften Lebensmitteln auferlegen,
nur um sicher zu sein, dass sie auch nicht eine Spur von Milch
enthalten;
wir können hungern bis unsere Gesundheit in Gefahr ist;
wir können uns hämisch freuen über unseren
"Erfolg" und die weniger Eifrigen unter uns verurteilen.
Das aber macht die Fastendisziplin zu einer Farce.
Viele Orthodoxe, die im Westen leben, stehen vor einem Dilemma, wenn
sie von Nicht-Orthodoxen eingeladen werden,
die unsere Fastenpraxis nicht kennen, oder auch von Orthodoxen, die
sich nicht darum scheren.
In diesen Fällen sind Ausgewogenheit und Masshalten besonders
gefragt.
Um Stolz auf unser Fasten zu vermeiden, ist es gesund und
vernünftig, das Gebot zur richtigen Zeit zu lockern.
" Durch die Lockerung unserer gewöhnlichen Praxis, "
rät der Hl. DIODOKOS von Photiki,
" können wir unsere Selbstbeherrschung in Demut verborgen
halten ".
Wenn wir in Gefahr sind andere mit unseren Fasten zu beleidigen, ist
der Rat des Hl. PAULUS eine gesunde Daumenregel:
" ... esst, was euch vorgesetzt wird " (1Kor 10:27)
Doch beantwortet solcher Rat nicht die Frage, warum wir gerufen
-eingeladen- sind, Fastenregeln zu akzeptieren,
sei es eine totale Abstinenz für kurze Zeit oder
eingeschränkte Nahrung während längerer
Fastenzeiten.
Evagrios Pontikos, ein georgischer Mönch, der 399 in der
Abgeschiedenheit der ägyptischen Wüste starb,
beschreibt uns die richtigen Gründe, warum das Fasten im
christlichen Leben so wichtig ist:
" Faste vor dem Herrn so gut du kannst, " rät er,
" denn damit wirst du von deinen Lastern und Sünden gereinigt;
es erhöht die Seele,
heiligt den Geist,
treibt Dämonen aus
und bereitet dich auf die Gegenwart Gottes vor
...
Sich der Nahrung zu enthalten, sollte dann deine eigene Wahl sein und
asketisches Bemühen ".
Elias, der Presbyter, ein Priestermönch des 11./12.
Jahrhunderts,
verdeutlicht dieses Ziel mit dem Bild des kommenden Reiches.
"Wer Fasten und das unablässige Gebet praktiziert,
das eine zusammen mit dem anderen,
wird sein Ziel, die Stätte aus der ´Kummer und
Seufzen entfliehen´ (Jes 35:10 LXX) erreichen ".
Fasten dient dem Heil nur wenn es in Beziehung auf das Reich Gottes
gehalten wird.
Wenn es auch dazu dienen mag den Leib zu entgiften
und uns hilft unsere Versuchungen zu Völlerei und Genusssucht
in den Griff zu bekommen,
rechtfertigt dies keineswegs ihre Strenge.
Die Fastendisziplin hat nur einen grundlegenden Zweck: uns auf das Fest
vorzubereiten.
Wir enthalten uns völlig des Essens bevor wir die Heilige
Kommunion empfangen,
nicht nur um den Bauch zu leeren,
sondern um Hunger für die wahre Eucharistie zu schaffen,
das Himmlische Mahl, das für uns bereitet wurde vor der
Erschaffung der Welt.
Das gleiche gilt für die langen Fastenzeiten unseres
Kirchenjahres.
Sie helfen sehr bei der lebenswichtigen Aufgabe, die "Zeit zu
heiligen",
Herz und Geist der überweltlichen Wirklichkeit und dem
Versprechen der erfüllten Hoffnung zu öffnen.
Fasten hat seine wahre Grundlage im gesamten sakramentalen Leben der
Kirche,
das den Gläubigen nährt und zum ewigen Leben, zu
Freude und Frieden im Himmelreich führt.
Es erhebt uns über die täglichen Sorgen unserer
irdischen Existenz,
um uns sicher auf die Flugbahn zu setzen,
die uns von diesem Leben ins nächste bringt.
Fasten ist kein Sakrament im strikten Sinne, aber es ist zutiefst
"sakramental".
Sakramental und eschatologisch, weil es unser gegenwärtiges
Leben und unser Tun heiligt,
unser Gebet -das persönliche, wie das gemeinschaftliche-
vertieft und verstärkt,
und in unserem innersten Sein einen entscheidenden Durst nach dem
versprochenen Mahl schafft, dem kommenden ewigen Fest.
Fasten ist die Mahnung, dass der Weg zur Herrlichkeit der Weg des
Kreuzes ist.
Fasten mag kleinere Unannehmlichkeiten auferlegen:
unseren Drang nach sofortiger Befriedigung enttäuschen
und uns schmerzlich daran zu erinnern, wieviele der Menschen dieser
Erde jede Nacht hungrig zu Bett gehen.
Aber das alles hat sein Gutes.
Denn diese Unannehmlichkeiten führen den Leib, den Geist und
die Seele zu dem, was wirklich wichtig ist:
zum himmlischen Jerusalem
in dem die Seele erhöht wird,
der Geist geheiligt
und die Dämonen besiegt,
und wir alle auf ewig in der Gegenwart Gottes weilen.
Quelle: http://www.holyapostles.org
* St. Andreas Bote:
empfehlenswerte Monatsschrift in deutscher Sprache mit ausgewählten aktuellen Texten der besten Theologen aus allen orthodoxen Traditionen und aktuellem Kalendarium
Fragen, Zuschriften an G.Wolf, Dammweg 1, 85655 Grosshelfendorf, 08095 - 1217; gerhard.wolf@t-online.de
jetzt auch online !
St. Andreas Bote - online
Herr und Gebieter meines Lebens,
Gib mir nicht den Geist des Müßiggangs, des Verzagens,der Herrschsucht und der Geschwätzigkeit.
(еine große Verneigung)
Schenke vielmehr mir, Deinem Diener, den Geist der Keuschheit, der Demut, der Geduld und der Liebe.
(еine große Verneigung)
Ja, Herr, mein König,
gewähre mir, meine Sünden zu sehen
und meinen Bruder nicht zu verurteilen,
denn gesegnet bist Du in alle Ewigkeit,
Amen.
(еine große Verneigung)
Das Gebet des Hl. Ephraim des Syrers
1) Faulheit (Müssiggang)
Der Geist der Faulheit (man kann dieses Wort im Original sehr verschieden übersetzen) hat in erster Linie mit dem Zustand unserer Seele zu tun, wenn in ihr kein Leben ist, wenn sie so vor sich her schlummert und erkaltet ist. Er ist ein Ausdruck für Leere in uns. Es ist die Leere, die das Evangelium mit einem leeren Haus bezeichnet, aus dem der böse Geist vertrieben worden ist. Es ist aufgeräumt, sauber und bereit, Gäste zu empfangen. Und doch ist es leer. Und das Evangelium sagt weiter, wie dann der vorher vertriebene böse Geist zurückkehrt und, wenn er nun sieht, dass es sauber und aufgeräumt ist, andere sieben noch furchtbarere Geister ruft und diese sich wieder in dieses leere Haus einnisten (Mt. 12,43-45). Das ist eine Warnung an uns. Wenn unsere Seele leer ist, wenn unser Herz leer ist und unser Verstand, wenn unsere Worte leer sind, ohne Geist und Leben - das doch eigentlich Dem gehört, Den wir als unseren Herren und Gebieter bekennen - dann ergreift sie, dann erfüllt sie etwas anderes. Deshalb ist das erste, wovor uns der Herr bewahren soll, der Geist der Faulheit, der Schläfrigkeit, der Leere – wie viele Wörter bezeichnen ein dasselbe – der der Grund für jegliche Zerstörung ist.
2) Die Verzagtheit.
Wenn wir in uns diesen Zustand, den ich gerade beschrieben habe, feststellen, dann sollten wir irgendwie handeln. Dafür bedarf es Entschiedenheit und Mut. Doch wir verzagen. Es ist so einfach auf etwas Besseres zu hoffen und doch so schwer, sich von der Stelle zu rühren. Es ist viel einfacher auch weiterhin in einer Welt der Illusionen zu leben, als wirklich aufzuwachen. Doch ein wirklicher Held ist der, der aufgewacht, der von sich schüttelt alle Schläfrigkeit, wer wirklich wachsam ist. Es ist derjenige, der nach den Worten vom Heiligen Serafim von Sarow entschlossen ist, lieber seine Ruhe und alles, was ihm teuer ist, entbehren zu müssen, als ohne Gott zu leben. Darin besteht der einzige Unterschied zwischen einem Sünder, der an seiner Sünde zugrunde geht, und einem Heiligen, der seiner Berufung gerecht wird, weil er Verzagtheit und Trübsinn in sich überwindet.Trübsinn ist Schlummern sehr ähnlich. Man lässt alles laufen, wie es so geht. Man flüchtet sich lieber eine Traumwelt, in eine virtuelle Welt, in die Illusionen. Der Schlummer wartet nicht auf die Nacht. Man schließt die Augen und könnte denken, es ist Nacht und Zeit zum Schlafen. Und ist es nicht merkwürdig, dass gerade dann, wenn uns die Kraft nicht ausreicht, etwas zu tun, wir uns voller Stolz in eine Welt der Macht und des Erfolges träumen? Wenn wir aber beschäftigt sind mit einer Sache, die unsere gesamte Aufmerksamkeit erfordert, dann ist das erste, was wir uns erträumen, die Sache auch zu leiten, dann erwacht in uns der Hunger nach Macht, dann treibt uns der Stolz. Neben unserer Verzagtheit steht unsere Feigheit, stehen Schlaffheit und ein Leben in Illusionen. Und in diesen Illusionen träumen wir von Macht, von Stärke und die damit verbundene Grausamkeit und Grobheit.
3) Geschwätzigkeit.
Es geht nicht darum, dass wir viel reden. Natürlich ist auch das damit gemeint. Doch es geht vielmehr um die Nichtigkeit unserer Worte. Unsere Worte tragen keine Früchte. Diese Fruchtlosigkeit wurzelt in Verzagtheit, Trübsinn und Träumerei, die zu Machthunger führt. Und so reden wir, wenn es eigentlich nicht sein sollte und leben in unserer Phantasie, statt in der realen Welt. Dies ist sehr wichtig, denn die Welt Gottes ist die Welt der Wirklichkeit. Die Welt des Satans ist die Welt der Illusionen, die virtuelle Welt. Die Welt Gottes ist ganz real und in ihr bestehen all die Schwierigkeiten und die Grausamkeiten der realen Welt. Der Satan schlägt uns eine Welt vor, in der nichts wirklich ist, obwohl alles möglich erscheint. Wir fühlen uns dann stark. Unser Stolz ist befriedigt. Wir können uns innerlich rühmen. Wir können uns anders denken, als wir in Wirklichkeit sind. Wir sind wichtig und mutig, obwohl wir noch nichts getan haben. Wir schlafen und die wirkliche Welt gehört denen, die wach sind.So geht es in den ersten Worten des Gebets um das Allerwichtigste. Wenn ich Gott als meinen Herrn und Gebieter anerkenne, wenn ich mich bemühe, in der Wirklichkeit zu leben, wenn ich darum ringe, die dämonische Welt der Phantasie und Virtualität von mir zu stoßen, wenn ich mit allen Kräften versuche, wirklich zu leben, um dem Tod zu entkommen – denn Leben und Wirklichkeit gehen Hand in Hand, so wie der Tod zusammen mit der Illusion – dann sollte ich begreifen lernen, was konkret und ganz real diese Worte bedeuten: Sie beschrieben nicht nur einen Zustand in der Seele, sie sind vielmehr ein Programm zum Handeln, denn jedes dieser Worte sollte für uns eine Herausforderung darstellen, eine Losung, eine Devise, die uns dazu zwingt, auf bestimmte Weise zu agieren.Wie? – das verraten uns kurz die nächste Zeile: Gib mir, Deinem Knecht, vielmehr einen Geist der Keuschheit, der Demut, der Geduld und der Liebe.
4) Keuschheit ist nicht nur eng in ihrem Bezug auf unseren Leib zu verstehen, so wie auch Jungfräulichkeit nicht nur ein physischer Zustand ist. Keuschheit beginnt in dem Moment, in dem wir uns der erstrangigen Wertmaßstäbe bewusst werden und uns um sie bemühen: um Gott und um den Menschen, wenn wir in unserem Verhältnis zu Gott und zu dem Menschen (uns selbst eingeschlossen) ehrfürchtig auftreten, wenn wir unseren eigenen Leib so ehren, wie wir es mit dem Brot und Wein tun, die sich in den Leib und das Blut Christi verwandelt haben, wie wir den Leib des Mensch gewordenen Gottes verehren würden und daraus schlussfolgernd jeden ehren würden, dem wir begegnen. Keuschheit beginnt damit, dass wir begreifen, dass jeder Mensch zur Ewigkeit berufen ist, dass er wertvoll ist in den Augen Gottes, dass er das Heil erlangen aber auch ins Verderben stürzen kann. Der Mensch kann ein Objekt der Verehrung sein und wir sind dazu aufgerufen, wie Christus gesagt hat, als er Seinen Jüngern die Füße wusch, dass auch wir einander die Füße waschen, dass wir einander treu sein und einander in Demut und Liebe dienen sollten. Nur wenn wir in einem solchen Geist leben, können wir ihn im gesamten Menschen zum Blühen bringen: in der Seele, im Leib und einen solchen Zustand der Seele, des Verstandes und des Herzen erreichen, der uns zu einer völligen und ständigen Reinheit des Leibes führt, was wir dann als Keuschheit bezeichnen.
5) Demut ist etwas viel Größeres als die traurige Karikatur, die wir oft darstellen. Es scheint uns, dass Demut darin besteht, dass wir uns immer wieder einreden, keiner Beachtung durch andere würdig zu sein, obwohl wir in Wirklichkeit so nach ihr dürsten. Oder wir behaupten, dass wir etwas Unwichtiges geleistet haben, obwohl wir eigentlich wissen, dass wir etwas Gutes und Wichtiges getan haben. Es hätte aber keinen Wert, weil wir es getan haben. Das ist keine Demut. Wirkliche Demut heißt in erster Linie, sich selbst zu vergessen und sich dabei ernsthaft, tiefgreifend und kreativ um Gott und seinen Nächsten zu kümmern. So, dass wir gar kein Interesse daran haben, uns auf uns selbst zu konzentrieren. Es ist ein Zustand, in dem wir, wenn wir uns plötzlich wichtig nehmen, zu uns sagen: Geh mir aus dem Weg! Du bist kleinlich und niedrig und so uninteressant! Ich möchte mich mit sehr viel Wertvollerem beschäftigen!Demut hängt auch mit dem Sieg über unsere Sucht nach Anerkennung und über unseren Stolz zusammen.
6) Demut steht in Verbindung mit Ruhmsucht. Nicht nur, weil sie ganz offensichtlich ihr Gegenteil darstellt. Ehrsüchtig ist vielmehr der, der nach Anerkennung in den Augen der Menschen strebt, nicht aber von Gott. Wenn man aber bedenkt, von welchen Menschen wir uns Anerkennung erhoffen oder wofür wir gerne gelobt werden wollen, dann sehen wir, wie niedrig wir uns selber machen durch diese Sucht nach Anerkennung. Der Anlass für diese Ruhmsucht kann etwas sehr Unbedeutendes sein: ein Witz, ein Erfolg, der eigentlich in keinem Verhältnis zur eigentlichen Größe des Menschseins steht. Es kann sein, dass wir sogar denjenigen, die uns verachten, aber trotzdem beklatschen, noch dankbar sind für ihr Lob. In beiden Fällen, sei es nun wegen des Anlasses oder wegen der Leute, macht uns die Ehrsucht zu unwahrscheinlich kleinen, leeren Wesen, die eigentlich zu nichts Nütze sind. Sie führt uns zur Nichtigkeit. Demut beginnt vielmehr da, wenn wir anfangen, unsere Urteile nicht mit denen der Menschen zu vergleichen, mit den oberflächlichen und zufälligen Bemerkungen der Leute, sondern mit der wahren Größe des Menschseins, mit der Fülle der Wahrheit Gottes. Demut besteht darin, kein anderes Maß für sich anzunehmen, als nur die Größe des Menschseins vor dem Urteil Gottes.Das ist der Grund, warum die Heiligen demütig waren, warum sie begriffen hatte, wie groß der Mensch ist und gleichzeitig, wie weit sie selbst von ihrer Berufung entfernt waren. Denn sie wussten, dass uns die die wirkliche Größe des Menschen in Jesus Christus offenbart worden ist (Röm. 5,15). So konnten sie mit wahrer Demut sich eingestehen, wie unwürdig sie doch selbst waren. Denn sie wussten, dass Gott wollte, dass wir Seine Freunde seien, Seine engen Weggefährten. Und so konnten sie auch das ganze Ausmaß und die Tiefe unseres Falls begreifen und den Abgrund zwischen uns und Ihm ermessen und so ihrer Demut beweisen. Aus der Schau der Größe des Menschen und der Herrlichkeit Gottes wird im Menschen die Demut geboren. Nicht aber aus dem ständigen Sich Bewusstmachen der eigenen Misserfolge oder der eigenen Unwürdigkeit. Darüber habe ich schon einige Male gesprochen: Demut, im englischen humility kommt vom lateinischen Wort „humus“. Fruchtbarer Boden. Dies ist ein sehr passendes Bild. Die Erde, der Boden ist immer da. Auf ihm gehen wir und er lässt mit sich machen, was wir wollen. Er nimmt unseren Müll an, aber auch lebendigen Samen und Sonnenstrahlen und Regen. Er kann alles aufnehmen und daraus Früchte hervorbringen. Man denkt nicht an ihn. Er schweigt. Er hält alles aus und bringt doch Frucht. Darin besteht Demut.
7) Geduld ist ein anderes gehaltvolles Wort. Es ist nicht nur die Fähigkeit geduldig seinen Nächsten zu ertragen. Es ist die Fähigkeit, Leid auszuhalten, Schwierigkeiten, Einschränkungen, beliebige Lasten zu tragen, angefangen von sich selbst bis hin zum Tod am Kreuz. Geduld bedeutet Kraft, Glauben, Schweigen. Dies alles führt uns auch zur Liebe und beginnt in der Liebe. Liebe ist die Fähigkeit alles zu geben, was man hat: auch sich selbst. Es ist die Fähigkeit, den anderen voller Ehrfurcht in seinem Anderssein anzunehmen, voller Verehrung und Freude. Es ist die Fähigkeit, sein Leben für seine Freunde hinzugeben und Opfer zu bringen. Wenn hier Parallelen zu dem vorher Gesagten gezogen werden sollen – und das schlage ich euch vor, selber zu tun – kann man sehen, dass in der Liebe die Antwort auf die ersten vier Bitten enthalten ist. So lebt der, der für die Wirklichkeit erwacht ist, der vor dem Angesicht Gottes und des Menschen, vor sich selbst und vor seiner eigenen Berufung wandelt, der bereit ist, zu handeln und der all dies als Grund und als Endziel betrachtet, mit Liebe, denn sie ist die Fülle des Lebens.Und am Ende beten wir, obwohl wir damit auch hätten beginnen können, denn für Ephrem dem Syrer war dies vielleicht die gewohnteste Erfahrung des Lebens: Herr und König, lass mich meine eigenen Sünden erkennen und nicht meinen Bruder verurteilen!
Amin.
(Entnommen dem Buch: „Durch das Kirchenjahr“ von Metropolit Anthony (Bloom)
VOR
- FASTENZEIT
"Der
UMKEHR Türen öffne mir ..."
~~~
Komponist: Artemij WEDEL /// Interpretation: F.TSCHALJAPIN mit Chor der
Russischen Orthodoxen Kathedrale Paris 1932 ~~~
3. Sonntag FLEISCHENTSAGUNG
!
vom GERICHT
15.2.
2026
4. Sonntag BUTTERENTSAGUNG
!
vom VERLUST des PARADIESES VERGEBUNGSSONNTAG
22.2.
2026
- abends:
BEGINN der GROSSEN 40-taegigen FASTEN
Vor - Fastenzeit
Weil die Kirche mit ihrer 2000-jährigen Erfahrung ein tiefes psychologisches Mitgefühl mit der menschlichen Natur entwickelt hat. Sie kennt unseren Hang uns von den Oberflächlichkeiten unserer Umwelt einnehmen zu lassen und unsere mangelnde Konzentrationsfähigkeit auf die geistlichen Güter. Ein rascher Wandel unserer Alltäglichkeit, ein unvermitteltes Hinüberwechseln in eine noch nie auch nur erspürte Praxis birgt die Gefahr uns zu überfordern. Wir dürfen nicht Wunder fordern, sondern wir bereiten uns auf immer wieder neue Anstrengungen vor. Wir müssen uns darauf vorbereiten, nach jedem Fall niemals die Anstrengungen des Aufstehens zu scheuen, wieder an die Türen der Umkehr zu klopfen und uns wieder auf den Weg zu machen.
Dieser Mut und die Bereitschaft das Ringen auch durch Entbehrungen durchzuhalten ist besonders für die Zeit der Grossen 40-tägigen Fasten notwendig. Das aktive, bewusste Fasten ist ein deutliches Bekenntnis zur Möglichkeit der Überwindung der "animalischen Naturgesetze" und ein Zeichen der Bereitschaft zu wahrer Menschlichkeit im Ebenbilde Gottes.
Wenn wir dies Bedenken, dann wird uns das Fasten nicht als unliebsame Einengung erscheinen. Wir werden erkennen das Fasten nichts mit Trübsinn zu tun hat, sondern mit Freude die Gelegenheit zur Erneuerung des Lebens ergreifen.
Deshalb wollen wir das Fasten nicht nur als
äusserliche
Übung
der "Gesetzestreue" sehen, sondern als Gelegenheit uns dem Heil der
Vergöttlichung zu nähern:
Beginnend mit der Bitte, dass sich auch
für uns die
"TÜREN der UMKEHR" öffnen mögen !
Diese Zeit soll genutzt werden, um uns zu Besinnen, uns zu überlegen und wenn möglich mit dem Beichtvater abzusprechen in welcher Weise wir am Fasten der Kirche in unseren konkreten Lebensumständen teilhaben können. Realistischerweise wird uns nämlich ausser in Klöstern die genaue Einhaltung aller Fastenregeln der Kanones (kat´akrib ei an) nicht so ohneweiteres möglich sein. Gleichzeitig wird ein am Sinn und nicht nur am Buchstaben orientiertes Fasten auch weitgehenden Verzicht auf die Genussmittel, Süssigkeiten, Fernsehen und andere "Suchtmittel" unserer Zeit bedeuten. Dies vor allem, um frei zu werden, die "Lebensqualität" eines inneren geistlichen Lebens für uns neu zu entdecken und zu intensivieren.
Die Vorfastenzeit bietet Gelegenheit zur konkreten Planung dieser Umkehr. Aus praktischer Erfahrung ist es auch empfehlenswert die Umsetzung der Pläne "austesten", um für die 40 Tage nur Vorsätze zu fassen, die wir dann auch weitgehend umsetzen können.
Wichtig ist es aber auch, sich auch gleich darauf vorzubereiten, dass wir nach jedem Fall auch wieder bereit sind aufzustehen - und das "Rennen" fortzusetzen. Nicht umsonst werden wir auch an die 40 Jahre erinnert, in denen das Volk des Herrn auf dem Weg durch die Wüste die neu gewonnene Freiheit erprobte:
- aber auch immer wieder durch Gottes Gnade und menschliche Anstrengung wieder versöhnt mit dem Schöpfer des Lebens.
ER will uns nie vernichtend strafen, sondern wie es uns Christus während Seiner 40 Tage in der Wüste gezeigt hat, immer wieder für uns und unsere Erlösung mit dem Satan, dem Versucher, ringen. Wir können darüber umso mehr Freude empfinden, je öfter wir nach unseren Sündenfällen wieder aufstehen und den Kampf wieder aufnehmen.
"Nur vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und nur ihm allein dienen" (Lk 4,8) erinnert uns der Apostel an dieses Privileg der "Synergie", der Einladung Gottes an uns, unsere begrenzten Kräfte mit Seiner Allmacht zu verbinden.
Bereiten wir uns auf die freudebringenden
Anstrengungen dieses Kampfes
vor, um dann nach der "Vollendung der 40 Tage" auch mit wenigstens
teilweise verdienter Freude die Früchte der Auferstehung
ernten zu
dürfen !
~~~ Komponist: Artemij WEDEL /// Interpretation durch grossen Chor ~~~
www.musicarussica.com - RealAudio
Der Umkehr Pforten öffne mir,
Du, Der Du das Leben schenkst !
...
Denn durch schändliche Sünden habe ich meine Seele befleckt
und mein Leben in Nachlässigkeit vergeudet.
...
In Deiner Güte mache mich rein
durch Deine huldvolle Milde !
~~~vollständig:Chor der Christi-Verklärungskathedrale, Moskau /Regent Vladimir LVOV~~~
aus: "http://en.liturgy.ru/zvuk/zvuk.php"
"An den Flüssen von
Babylon ..."
~~~ Na Rekach Babylonskich ~~~
Chor des Klosters in Pyuchtiza
Sonntag der
beginnenden FLEISCHENTHALTUNG
Sonntag vom Gericht
Apostel:
1 Kor 8:8 - 9:2
Evangelium: Mt 25: 31 - 46
Dieser
Herrentag wird nach dem Evangelium "vom Gericht" oder nach der
Tradition der Kirche "Herrentag der Fleischenthaltung"
(= APOKREO = MESOPUSTNA = Carne val) genannt. Mit dem Abendgottesdienst
an diesem Sonntag beginnen die Gläubigen sich in
Fleischenthaltung zu üben.
In der folgenden Woche wird der Körper noch einmal mit Milch,
Butter und Käse gelabt, bevor danach am Abend des
nächsten Sonntags die Grossen 40-tägigen Fasten vor
der österlichen Festzeit beginnen.
Unser Fasten nimmt dieses Friedensreich im Glauben vorweg.
Die Apostellesung betont wieder einmal die wahrhaft christliche Freiheit gegenüber allen religiösen Speisevorschriften:
Brüder,
Speise wird uns nicht vor Gott bestehen machen;
weder fehlt uns etwas, wenn wir nicht essen,
noch gewinnen wir etwas, wenn wir essen"
(1 Kor 8:8 )
Erwählten wie Verworfenen,wird nach ihrem Tun Heil oder Unheil zuteil:
Aber sie erkennen erst jetzt, dass nicht die Befolgung irgendwelcher hochgesteckten abstrakten Prinzipien sondern die Art ihres Verhaltens gegenüber dem Schwächeren Mitmenschen entscheidet !
Vor dem ewigen Gericht werden jene in das Reich Gottes eingehen, die ihre Liebe konkret an ihren Mitmenschen bewiesen haben:
Sünde ist Trennung und Isolierung von Gott, da Gott der Absolut Liebende ist. Und so wie Gottes Liebe zu uns konkreten unwürdigen menschlichen Individuen sind wir zu konkreter Liebe zu jeder menschlichen Person aufgerufen, der uns Gott in unserem Leben begegnen läßt.
Die christliche Liebe ermöglicht uns in jedem Menschen, der uns begegnet Christus zu sehen. Jeden Menschen, den Gott in Seinem unerforschlichen und ewigen Plan in mein Leben geführt hat, und sei es auch nur für einige Augenblicke, hat Er zu mir geführt um mir Gelegenheit zu geben an Seiner Liebe zu allen Geschöpfen teilzuhaben. Denn ist Seine Liebe nicht jene alle Äußerlichkeiten, alle Andersartigkeit, alle Herkunft und Intellektualität übersteigende Kraft die zur jeweils einzigartigen personalen Wurzel seines menschlichen Seins vorstößt, das wir getrost makellos und absolut sehen dürfen: seine ihm vom Schöpfer eingehauchte Seele, die wahrhaft göttliche Seite jedes Mitmenschen. Die christliche Liebe ist tätige Bekräftigung dieses Glaubens. Und diese Liebe ist so wie Gottes Liebe immer konkret. Wir sind damit nicht aufgerufen, allgemein und abstrakt die "Menschheit" allgemein und nicht in Form irgendwelcher Pläne für die Zukunft, die konkret gegen einzelne Personen und in einer konkreten "Etappe" "über Leichen geht", zu lieben, sondern immer die konkrete Person, die HIER und JETZT vor uns steht !
Wir wissen, dass alle Menschen dieser personalen Liebe bedürfen - dem Erkennen ihrer einzigartigen Seele in ihnen, in der sich die Schönheit der ganzen Schöpfung in einzigartiger Weise widerspiegelt.
Und so haben auch wir diese Liebe nötig:
Jetzt - und am Tage unseres Gerichtes !
Wir können das ewige Heil nicht erlangen, ohne die verzeihende Liebe dessen, der uns durch den Hauch Seiner Liebe das Leben gegeben hat und Der uns dann daran messen wird,
ob wir diese Liebe erhalten und weitergegeben haben.
Wenn Du, o Gott, kommen wirst
auf Erden in Herrlichkeit
wird das All erzittern
und von Deinem Richterstuhl ein Feuerstrom ausgehen,
die Bücher werden geöffnet und das Verborgene wird
offenbar.
Dann errette mich aus dem nie erlöschenden Feuer
und würdige mich,
zu Deiner Rechten zu stehen,
gerechtester Richter !
Kommet, lasset uns dem Herrn frohlocken,
jauchzen dem Fels unseres Heils !
Lasset uns vor Sein Angesicht treten
mit unserem Bekenntnis !
Mit Psalmen lasset uns Ihm zujubeln !
"Die
Tueren zur Umkehr, oeffne mir, Lebensspender ! ..."
~~~
Komponist: Artemij WEDEL /// Interpretation: F.TSCHALJAPIN mit Chor der
Russischen Orthodoxen Kathedrale Paris 1932 ~~~
Der
Umkehr
Pforten öffne mir,
Du, Der Du das Leben schenkst !
frühmorgens strebt zu Deinem
heiligen Tempel
mein Geist,
er trägt den ganz befleckten Tempel meines Leibes¸
doch als der Gütige
reinige ihn
durch Dein wohlwollendes Erbarmen.
...
denn durch schändliche Sünden habe ich meine Seele befleckt
und mein ganzes
Leben im Leichtsinn vergeudet;
doch du
rette mich durch deine Fürbitten von jeder Unreinheit.
...
Die Menge der von mir begangenen Missetaten bedenkend,erschaudere
ich Armseliger vor dem
furchtbaren Gerichtstag;
aber hoffend auf Deine Güte,
rufe ich wie David zu Dir:
Erbarme Dich meiner, o Gott, nach Deinem großen
Erbarmen.
Sünde, UMKEHR, Reue
und
Vergebung in der Hl.Schrift
und die Bedeutung für uns.
Aus dem 2.Vortrag von Vater
FJODOR
Hölldobler, Herbstseminar 1998
Bischofsheim a.d.Rhön
Hier wird der "büssende David" genannt, "der sich von seinen Verfehlungen bekehrt hat".
David
war ohne Zweifel der modernste Staatsmann im Vorderen Orient
seiner Zeit. Er war kein orientalischer Despot,
sondern hing persönlich an der Überlieferung seines
Volkes,
die aus der Wüstenzeit herkam. Er war Landsknecht,
Künstler,
Gottsucher, Prophet und Fürst zugleich. In David verstand sich
Israel aufs neue von Gott erwählt und geführt. Aber
in David
hatte alles Menschliche Raum, im Guten wie im Bösen, wie diese
Geschichte zeigt. Die Busse, zu der David fähig war, zeigt
seine
Grösse als religiöser Mensch, als Prophet und
Künder des
Bussgedankens.
Gemeint ist die Frau, die ins Haus kam, als er Gast im Hause des Pharisäers Simon war, Lk 7: 37. Die Erzählung vom Mahl beim Pharisäer Simon wird von Lukas allein überliefert, ist jedoch mit jener von Mt 26: 7 -13 verwandt, wo eine Frau im Hause Simons des Aussätzigen in Betanien Jesu Füsse salbt. Dort ärgert sich manch einer unter den Jüngern Jesu wegen der "Verschwendung", hier hingegen der Pharisäer, weil die Frau eine Dirne ist, die mit Jesus in Kontakt kommt. Diese Begebenheit ist Anlass für eine bemerkenswerte Lehre des Evangeliums (7:47): Wer für viele Sünden Verzeihung erlangt hat, wird viel Liebe zeigen.
Wenn wir nun die genannten Schriftstellen vergleichen, so sehen wir, dass die genannten Sünden eine gemeinsame Wurzel haben.
Das ist einfach die GOTTVERGESSENHEIT.
Manasse erliegt den Einflüsterungen seiner Ratgeber, die ihm versprechen, dass er so reich und mächtig würde wie die Assyrer, wenn er Götterbilder aufstellen lässt so wie sie, und vergisst seinen Gott. Wer seinen Leib der Hurerei hingibt, der vergisst, dass dieser ein Tempel Gottes ist ( 1 Kor 3: 16 ). "Hütet euch vor der Unzucht ! Jede andere Sünde, die der Mensch tut, bleibt ausserhalb des Leibes.
Wer aber Unzucht treibt, versündigt sich gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt ?" ( 1 Kor 6: 17 )
Als Petrus sagt: "Ich kenne diesen Menschen nicht !" hat er Ihn in diesem Augenblick tatsächlich nicht mehr gekannt. Er hat alles vergessen aus der existentiellen Bedrohung heraus.
Deshalb verwendet die Orthodoxie soviel
Kraft auf die
Heiligung der
Sinne, auf die Vergöttlichung der sinnlichen Sphäre,
um dem
Menschen die Verführbarkeit durch die entsprechenden Anreize
zu
nehmen.
Adam und Eva "vergessen" Gottes Gebot / Kain vergisst seinen brüderlichen Auftrag / Noahs Zeitgenossen vergessen ihren Schöpfer / die Turmbauer zu Babylon vergessen Gottes Allmacht / Jakobs Brüder vergessen, dass Gott erwählt / die Israeliten vergessen Seine Führung und beten das goldene Kalb an / zwei Söhne des Aaron vergessen ihren priesterlichen Dienst und meinen "Feuer ist Feuer" / das Volk vergisst seinen Ernährer und wünscht sich zurück an die ägyptischen Fleischtöpfe / Aaron und Miriam vergessen, dass sie sich nicht mit Moses vergleichen können und dass Er -ihm- das Volk anvertraut hat / Korah und andere Gemeindevorsteher vergessen, dass Moses der von Gott erwählte Führer ist und bestreiten seine Autorität, mit dem Argument, die ganze Gemeinde sei heilig. / Vor der Schlangenplage vergessen die Leute Gottes Wohltaten und lästern gegen das Manna / im Gelobten Land vergessen sie wieder Gott und beten fremde Götter an, die Kanaaniter können sie besiegen.
Die Gottvergessenheit durchzieht die ganze Geschichte des Gottesvolkes.
Kaum ging es allen gut und sie lebten in Frieden vergassen sie Gott und kehrten erst durch die Umstände belehrt zurück.
Die Rückkehr ins Vaterhaus geschieht durch das Busssakrament.
Joh 20: 19 - 23 berichtet seine Einsetzung.
Das Gebet des Priesters bei, bzw. vor
der Beichte zitiert Mt 18: 22,
wo
der Herr auf die Frage des Petrus hin sagt, dass die Sünden
siebenundsiebzigmal vergeben werden sollen.
Der Neue Bund hat uns
Gottes verzeihende Liebe nahegebracht und der Priester, der die Macht
hat, zu binden und zu lösen,
wird sich in verantwortungsvoller
Weise darauf einstellen .
"Die
Tueren zur Umkehr, oeffne mir, Lebensspender ! ..."
~~~
Komponist: Artemij WEDEL /// Interpretation: F.TSCHALJAPIN mit Chor der
Russischen Orthodoxen Kathedrale Paris 1932 ~~~
zur Link-Quelle: "http://www.musicarussica.com"
22.2.
2026
Sonntag vom VERLUST
des PARADIESES
VERGEBUNGSSONNTAG !
BUTTERENTSAGUNG !
- am Abend des
Sonntags:
BEGINN der GROSSEN 40-taegigen FASTEN
"Über die
Vergebung"
von Erzbischof Antonij von Surozh (London)
Apostel:
Rm 13:11 - 14:4
Evangelium: Mt 6: 14 - 21
Das
Evangelium dieses Sonntags, an dessen Abend die Grossen Fasten
beginnen, erinnert uns daran, dass wir Vergebung vom Herrn erst
erwarten können, wenn wir nicht selbst bereit sind, unseren
Mitmenschen zu vergeben, was sie uns an Verletzung zugefügt
haben - und sie unsererseits um Vergebung zu bitten für das,
was wir bewusst oder unbewusst an ihnen gefehlt haben.
Darum findet an diesem Sonntagabend nach der Vesper in die Handlung des
Gegenseitigen Vergebens statt, wie sie am Schluss des Apodipnons in
Klöstern täglich geübt wird. In manchen
Kirchen wird
dieser Ritus aus praktischen Gründen unmittelbar nach der
Liturgie
ausgeführt. In den Häusern ist die Vergebung als
Abschluss
der Karnevals- und Butterwoche mit einem Fest vor allem für
die
Kinder verbunden, dabei werden zum letzten Mal die Milch- und
Butterspeisen genossen.
Die folgende Woche ist ganz dem intensiven
Fasten gewidmet. Es beginnt die fortlaufende Lesung aus dem
Buch Genesis, die im Sündenfall und dessen Folgen
mündet. Mit dem Verlust des uns von Gott bereiteten Paradieses
durch unsere selbstzerstörerischen Abwege beginnt auch die
Sehnsucht nach dem Ende der widernatürlichen Sünden
und dem neuen Paradies. Die dafür erforderliche Bereitschaft
zur Umkehr wird in der kommenden Woche durch das Gebet des heilsamen Busskanons des
Hl.Andreas von Kreta
gefördert. Wir fühlen mit, dass wir mit unseren
Sünden nicht allein sind, aber werden auch dazu ermutigt, uns
den Figuren des Bibel anzuschliessen, die den Mut fanden, Gott um
Vergebung zu bitten, und Ihm damit wieder nahe zu kommen.
Trotz -und vielleicht wegen- all unserer negativen Erfahrungen ruft uns
die Apostellesung zu:
"
Jetzt ist unser Heil näher als damals, da wir gläubig
wurden.
Die Nacht ist vorgerückt, der Tag hat sich genaht "
(Rm 13:11 ff)
Für die Fastenzeit wird uns mitgegeben:
"
Wer isst, soll den nicht verachten, der nicht isst;
und wer nicht isst, soll den nicht richten, der isst;
denn Gott hat ihn angenommen.
Wer bist du denn, dass du einen fremden Knecht richtest ?
Seinem eigenen Herrn steht oder fällt er - aber er wird
stehen; denn der Herr hat die Macht, ihn aufrecht zu erhalten "
(Rm 14: 3-4)
Führer auf dem Weg
der Weisheit,
Urgrund des Verstandes,
Lenker der Unverständigen
und Beschützer der Armen,
festige, unterweise mein Herz, Gebieter.
Gib mir das Wort, Du Wort des Vaters !
Denn, siehe, nicht lassen ab
meine Lippen zu Dir zu schreien:
Barmherziger,
erbarme Dich meiner,
des Gefallenen !
(Kondakion)
Über die
Vergebung
zum Sonntag der Vergebung
von Erzbischof Antonij von Surozh (London)
Wenn mir jemand ein Unrecht zugefügt hat, das ich vergebe und vergesse, dann sind wir beide in Gefahr, dass das gleiche sich wiederholt, denn einerseits entsteht und vergeht diese Verzeihung auf der Stelle: sie ist nichts Beständiges und auf die Zukunft hin Ausgerichtetes.
Etwas Vergangenes ist an eine Grenze gelangt, die es nicht überschreitet;
die Zukunft ist ohne Erfahrung aus der Vergangenheit.
Andererseits, wenn ich vergesse, vergesse ich zweierlei: wohl vergesse ich das Unrecht, das mir angetan wurde, gleichzeitig aber auch den Grund, aus dem es mir zugefügt wurde, und ich kann den Betreffenden niemals vor der Versuchung bewahren, in die gleiche Situation zurückzuverfallen.
Man
muss sich erinnern, dass dieser Mitmensch, sobald er in jene
bestimmte Lage versetzt wird, diese bestimmte Schwierigkeit hat;
folglich darf man ihn nicht wieder in dieselbe Lage bringen;
man muss die zurückbleibende Schwäche erkennen.
Darum ist es so wichtig, sich zu erinnern, denn das ist die einzige
Möglichkeit das Verzeihen fortzusetzen.
„Ich habe dir deine ungeduldige Handlung verziehen, aber ich
habe
dadurch entdeckt, dass diese bestimmte äußerung,
jene Geste,
diese besondere Situation sie hervorrufen können.“
Es gilt, den andern vor diesen Situationen zu bewahren, solange, bis
man ihm geholfen hat die notwendige Kraft zu gewinnen, die Spannung zu
überwinden. Andernfalls stoßen wir unsere
Mitmenschen
ständig neu in Situationen hinein, wo sie unfehlbar auf die
gleiche Weise reagieren werden, wie sie das Problem hervorrief.
Außerdem
ist das Verzeihen eine besondere Weise, einen anderen
Menschen anzunehmen.
Das beginnt in dem Augenblick in dem man sagt: „Ich nehme
dich
an, so wie du bist. So wie du bist trage ich dich, wie man ein Kind
über eine schwierige Stelle hinwegträgt oder wie man
ein
Kreuz trägt, aber ich weise dich nicht zurück. Zu
sagen, dass ich dich annehme, so wie du bist, heißt
keineswegs, dass du bist wie du sein solltest.“
Nur
wenn man einen Menschen so annimmt, wie er ist, kann man ihm helfen
sich zu ändern.
Aber man darf nicht zuerst fordern, er müsse sich
ändern, um ihm zu versprechen, hernach werde man ihn lieben.
Im Russischen sagt man: „Liebe mich schwarz ! Wenn ich erst
weiß bin, werden alle mich lieben.“
Es gibt nur Probleme wo der Mensch sie schafft. Ein Mensch aber, der
Probleme schafft, muss so sehr geliebt werden, dass er im Vertrauen den
Glauben an sich selber wiederfinden kann, die Selbstachtung und jene
schöpferische Hoffnung, die ihm ermöglichen wird,
sich zu ändern.
Folglich
übernimmt man mit dem Verzeihen die Verantwortung für
einen Menschen, so wie er ist, mit der Hoffnung auf die Zukunft, jedoch
ohne Bedingungen zu stellen!
Man verzeiht nicht unter Bedingungen. Es geht nicht an, einem Menschen
„mit Bewährungsfrist“ zu verzeihen. Das
zeigt sich sehr deutlich im Gleichnis vom Verlorenen Sohn.
Der Vater fordert nichts; ihm genügt es, den Sohn
wiedergekehrt zu
sehen, um zu wissen, dass er die Umkehr vollzogen hat, dass er
verändert zurückqekehrt ist. Verändert
bedeutet ganz und
gar nicht vollkommen. Er mag sich verändert haben und dennoch
für eine lange Zeit für die Familie schwer
erträglich
geworden sein. Dem Vater genügt es, dass sein Sohn
wiedergekehrt
ist; was noch zu tun bleibt, kann man gemeinsam überwinden.
Das
Verzeihen enthält vielerlei Elemente.
Zuerst muss einer kommen und um Verzeihung bitten oder doch wenigstens
einen Schritt in diese Richtung tun;
es ist nicht schwer, zu verzeihen, wenn man glaubt, im Recht zu sein;
es ist auch nicht schwer, einen Schritt entgegen zu kommen, wenn man im
Recht ist oder sich im Recht wähnt.
Darum muss derjenige, der im Recht zu sein glaubt, den ersten
Schritt tun.
Eine Gebärde, ein unmerklicher Hinweis, dass eine
Aussöhnung
erwünscht wäre, muss genügen, diesen Schritt
zwingend zu
machen.
Dann aber muss ein solcher Versuch zur Versöhnung
bedingungslos angenommen werden, denn ein Mensch kann sich
nur ändern im Maße der Hoffnung, die wir in ihn
setzen, im Maße der Liebe, die wir ihm zu geben
vermögen und im Maß unseres Glaubens an ihn
.
In
einer Gemeinschaft stellt sich das Problem anders.
Die Tatsache, dass ein Mensch Mitglied einer Gemeinschaft ist, kann ein
Problem bedeuten, nicht nur für einen Einzelnen, sondern
für eine ganze Gemeinschaft. Dann muss die Gemeinschaft zu der
zugleich kranken und heilenden Gemeinschaft der Kirche werden: krank,
weil jeder von uns ein Sünder ist und wir alle eine zutiefst
beschädigte Gemeinschaft sind; dennoch aber auch eine
Gemeinschaft, die fähig ist Gesundheit zu vermitteln, zu
heilen, das ewige Leben mitzuteilen. Denn
keine christliche
Gemeinschaft besteht nur aus ihren sichtbaren
Gliedern: Christus ist in ihrer Mitte, der Heilige Geist ist ihr
gegeben, und ob es die Kirche in ihrer Gesamtheit oder eine kleine
Kirchengemeinde ist – in der Gemeinschaft sind Gott und
Mensch
gänzlich für einander gegenwärtig, und wir
können
in Gott die Kraft finden, die wir als Menschen nicht besitzen.
Die Erfahrung, geliebt zu werden in vollem Bewusstsein dessen wie wir sind
– nicht trotzdem, oder weil man nicht wüsste, wie wir sind – ist ein sehr herrliches Geschenk, das Anlass zu Dankbarkeit und Demut wird und das aus unserem Leben ein demütiges Voranschreiten im Gebet macht.
Doch muss die Verzeihung auch angenommen werden.
Oft meinen Menschen, keine Verzeihung annehmen zu können, weil sie sich selber nicht verzeihen können. Selber können wir uns nicht verzeihen, aber wir müssen von einem anderen Menschen die Verzeihung annehmen können, – mag vorgefallen sein was will – dass er uns zugetan bleibt; was eine wahrhaft unverdiente Gnade ist. Und das ist schwer.
Viele Menschen vermögen auch in der Absolution Gottes Verzeihung nicht anzunehmen und können nicht absolviert werden. Gott hat verziehen – aber sie haben die Absolution trotzdem nicht erhalten.
Es ist auch schwer, die Verzeihung unverdient anzunehmen.
Es kann demütigend sein. Aber wenn wir besser verstehen lernen, wenn wir zu geben lernen, lernen wir auch zu empfangen. Einer, der sich selbst nicht verzeihen lassen kann, vermag auch selbst niemals zu vergeben. Einer, der nicht annehmen kann, geliebt zu werden, anerkannt zu werden, Hingabe zu empfangen, kann auch seinerseits nicht lieben, anerkennen, Hingabe aufbringen, denn derlei geschieht wechselseitig. Unverdient zu empfangen lernt man in staunender Freude, Demut und Dankbarkeit, mit der wir eine unverdiente Gabe beantworten. Und haben wir das erst entdeckt, können auch wir zu schenken beginnen ohne uns darum dem Empfangenden gegenüber überlegen zu fühlen.
Natürlich
ist unser Verzeihen nicht Gottes Verzeihen.
Doch müssten wir lange warten, bis wir so zu verzeihen
vermöchten. Aber wir können damit beginnen zu lernen,
uns gegenseitig in all unserer Begrenztheit anzunehmen. Es ist schwer,
um Verzeihung zu bitten, es ist auch nicht leicht, zu verzeihen, doch
Verzeihung zu verweigern ist ebenfalls schwer.
Am
Sonntag vor der Großen
Fastenzeit, nach dem Verzeihungsgottesdienst, der ein Gottesdienst der
Buße und der Hoffnung ist, sollen alle Glieder einer
Gemeinschaft
einander um Verzeihung bitten.
Jahrelang habe ich die Leute ermuntert, einander zu
vergeben;
dann habe ich beobachtet, wie sie mit Wärme und Enthusiasmus
Leute um Verzeihung baten, die sie niemals beleidigt hatten;
aber sie bewiesen sehr viel mehr Zurückhaltung bei anderen,
von denen sie selber Verzeihung zu erhoffen hatten;
und schließlich sah ich sie denen den Rücken kehren,
die keinerlei Bedürfnis hatten ihnen zu verzeihen, weil sie
sich ihnen gegenüber tatsächlich allzu rüde
verhalten hatten.
– Da habe ich zunächst verlangt, dass niemand
Verzeihung von
jemand erbitten sollte, den er nicht darum bitten wollte,
– weil er noch zu keinem Frieden mit ihm gefunden hatte.
Dann sollten sie sagen: „ich bitte Sie nicht um Verzeihung,
weil
meine Einstellung sich noch nicht geändert hat. Wenn Sie mir
verzeihen ändert das nichts; ich verabscheue Sie und habe die
Absicht, Sie auch weiterhin zu verabscheuen.“
Und von denen, deren Verzeihung man erbat, die sie nicht
gewähren konnten dass sie antworten sollten:
„Ich bin sehr bekümmert, aber mein Herz ist noch zu
schwer,
ich bin noch zu bitter, ich kann Ihnen noch nicht verzeihen.“
Dann
aber wurden beide Parteien aufgefordert, sich in der Beichte vor Gott
hinzustellen und ihm zu sagen:
„Herr, ich erwarte von Dir jetzt Vergebung. Selber Vergebung
zu
gewähren, verweigere ich. Ich erwarte einen Schritt auf mich
zu,
lehne es aber selbst ab diesen Schritt zu tun .....“ Jemandem
zu
sagen, „Ich lehne es ab, zu verzeihen,“ wirkt so
erschütternd, dass die Menschen zu denken beginnen. Gesagt zu
bekommen, „ich kann dir nicht mit Überzeugung
vergeben“ ist ebenfalls erschütternd.
Wenn
in einer Gemeinschaft der Mut aufgebracht wird, wenigstens so
aufrichtig zu sein, dass man es fertig bringt, zu sagen: „Ich
bin nicht imstande dir zu verzeihen;
das heißt nicht, dass du so schlimm bist, dass ich dir nicht
verzeihen könnte, sondern, dass ich so schlimm bin, es nicht
fertig zu bringen, dir zu verzeihen“, dann wird derjenige,
der nicht verzeiht, Gegenstand der Sorge und der Fürbitte der
Gemeinschaft, mehr als der andere, dem die Verzeihung verweigert wird
– solange, bis er Verzeihung erbitten kann.
Wenn
uns ein Mensch begegnet, so ist das niemals ein zufälliges
Zusammentreffen.
Dieser Mensch muss in unserer Gegenwart, unserm Blick, der Art, wie wir
ihn behandeln, der Art, wie wir auf der Straße an ihm
vorübergehen, eine Gottesgegenwart, lebendiges Gebet
spüren.
Jemand kommt, stets ist er mir ein Gesandter des Herrn: ob er mit einer
Botschaft kommt oder mit ausgestreckter Hand – wir sind
aufgerufen, eine Liebestat zu tun, eine Tat christlicher Liebe.
Jeder
Umstand, dem wir im Leben begegnen, ist gottgewollt, wir sollen in die
Situation eintreten und Gott gegenwärtig machen durch unsere
Gegenwart und unser Gebet. Ob ein Leben erfolgreich ist oder nicht
macht wenig aus im Hinblick auf das Gebet.
Was auch kommen möge, vor jeder neuen Situation
können wir bitten:
Herr, gib mir Einsicht,
gib mir ein Herz, das fähig ist, zu antworten,
gibt mir den rechten Willen,
sei gegenwärtig in dem was hier geschieht.
Wenn ein anderer spricht, können wir ständig beten und den Herrn bitten, uns verstehen zu lehren, nicht nur die Worte, die ausgesprochen werden, sondern das tiefe Bedürfen, die Wirklichkeit, die sich hinter den Worten oftmals verbirgt. Und wenn die Zeit gekommen ist und der andere nicht mehr spricht, kann man so lange schweigen und beten, bis man etwas zu sagen weiß; und wenn einem dann ein Gedanke gekommen ist, der die Klarheit und Gewissheit der Dinge hat, die von Gott kommen, – dann können wir ihn vorbringen und hernach Gott bitten, er möchte für den anderen Menschen bewirken, was wir nicht zu bewirken vermögen, er möchte, wenn wir einen Irrtum begingen, ihn uns verzeihen und ihn heilen, und wenn der Mensch gegangen ist, weiter für ihn beten.
Die
Art, wie man eine Frage stellt,
die Art, wie man zuhört, wie man eine Entfaltung
möglich oder
unmöglich macht, ist so wesentlich.
Einen Menschen, der nichts zu antworten weiß und sich
schämt, – mit dem Gefühl
zurückzuschicken,
völlig versagt zu haben
- oder doch mit ein wenig Hoffnung und der Freude, jedenfalls als
Mensch angenommen worden zu sein.
Alles
kann im Gebet verankert sein.
Man kann lernen, sich der Gegenwart Gottes ständig bewusst zu
werden, mit einem klaren, lebendigen Gefühl, ihm zugewandt
bleiben; jedoch immer mit voller Aufmerksamkeit; denn es ist vielfach
Unaufmerksamkeit, die nach und nach die Wirklichkeit aller Dinge
zerstört...
Übersetzung
aus dem Englischen: Irene Hoening
hier aus St. Andreas Bote
Vollständiges Fasten, wie in den Grossen 40-tägigen Fasten vor dem Auferstehungsfest vorgesehen, bedeutet Abstinenz von Fleisch, Eiern, allen Milchprodukten, Fisch, Wein und Öl. Der Speiseplan besteht also praktisch nur aus Gemüse, das ohne Öl zubereitet wird, Kartoffeln, Reis und Brot, wobei den Hülsenfrüchten (Erbsen, Bohnen jeder Art, Linsen) besondere Bedeutung zur ausgewogenen Ernährung zukommt. An den Samstagen und Sonntagen dieser Fastenzeit ist laut Typikon zusätzlich Wein und Öl erlaubt, was die Zubereitung der Speisen erleichtert. An einem besonderen Feiertag, wie zum Fest der Verkündigung an die Gottesmutters am 25. März (7.4.) aber z.B. nicht am Sonntag der Orthodoxie ! sind auch Fischspeisen erlaubt.
Dabei ist jedoch immer zu bedenken, dass die Fasten keine Zwangsjacke darstellen, sondern eine Hilfe, die die Abhängigkeiten aufheben und uns auf das Gebet hin orientieren sollen.
Dadurch gehört auch weitestgehender Verzicht auf "Zeitvertreib" und Unterhaltungsmedien.
Ernsthafte Bemühungen in der Überwindung persönlicher Schwächen sind notwendige Begleiter sinnvollen Fastens.
Hingegen sollte bei gesundheitlichen Problemen wirklich nur Überflüssiges dem Fasten unterworfen werden.
Damit hier keine Willkür oder unheilsame Unsicherheit aufkommt, sollte man sich immer mit dem "Geistlichen Vater", zu dem ein jeder Christ für seinen Nächsten werden kann, absprechen !
F A S T E N
Jes 58: 4 ff
+++
Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr
und schlagt mit gottloser Faust drein.
Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr es jetzt tut,
wenn eure Stimme im Himmel gehört werden soll.
Das aber ist ein Fasten, an dem ich Gefallen habe:
Loese die Fesseln derer, die du mit Unrecht gebunden hast;
Loese die Stricke des Jochs !...
Teile mit den Hungrigen dein Brot,
und die im Elend ohne Obdach sind, fuehre in dein Haus...
Dann wird dein Licht hervorleuchten wie die Morgenroete,
und dein Heil wird schnell voranschreiten,
und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen,
und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschliessen.
Dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten.
Wenn du schreist, wird ER sagen:
Siehe, hier bin ich !
Wenn du bei dir niemanden unterjochst
und nicht mit Fingern zeigst
und nicht uebel redest,
sondern den Hungrigen dein Herz finden laesst
und den Elenden seinen Mangel linderst,
dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis
und dein Dunkel wird sein wie der Mittag.
Und der Herr wird dich immerdar fuehren
und dich satt werden lassen in der Duerre
und dein Gebein staerken.
Und du wirst sein
wie ein gut bewaesserter Garten
und wie eine Wasserquelle,
der es nie an Wasser fehlt.
+++
So singen wir am Beginn der Fasten:
+++
Lasset uns ein Fasten halten,
welches dem Herrn gebuehrt und wohlgefaellig ist:
Entfremdung von boesen Taten,
Beherrschung der Zunge,
Enthaltung von Zorn,
Fernhalten von zwanghafter Begierde,
Verleumdung,
Luege und
Meineid.
Die Freiheit von diesen Dingen
ist ein wahres Fasten.
+++
Beweise es durch deine Werke:
Wenn du einen armen Menschen siehst, habe Mitleid mit ihm.
Wenn du siehst, dass ein Freund geehrt wird, dann beneide ihn nicht.
Lass nicht nur deinen Mund fasten, sondern auch das Auge und das Ohr und die Füße und die Hände und alle Glieder des Körpers.
Die Hände sollen fasten, indem sie frei von Gier sind.
Lass die Füße fasten, indem sie aufhören, der Sünde hinterherzulaufen.
Die Augen fasten, indem sie lernen, nicht auf das zu blicken, was sündig ist.
Das Ohr soll fasten, indem es nicht auf böses Gerede und Klatsch hört.
Der Mund soll fasten, indem er sich von bösen Worten und ungerechter Kritik fernhält.
Denn was nützt es, wenn wir uns vom Essen von Hühnern und Fischen fernhalten,
aber unsere Brüder beißen und verschlingen?
Hl. JOHANNES, der Mund Goldener Worte (Chrysostomus)
Warum wir fasten ?
Prof. Dr. John Breck
Charleston,USA - Paris,St.Serge
übersetzt von G. Wolf
St.Andreas-Bote
Viele
Christen haben
die überkommene Fastenpraxis aufgegeben.
In vielen heutigen westlichen Kirchengemeinschaften scheint sie
mühsam und unwesentlich.
Für diejenigen aber, die die heilende (eschatologische) und
heiligende (sakramentale) Bedeutung des Fastens schätzen, ist
es so wesentlich wie Essen und Trinken.
Warum fasten also die orthodoxen Christen ?
Für die meisten ist das Leben schon herausfordernd genug
ohne selbstauferlegte Schranken für das, was wir an gewissen
Wochentagen und während langer Perioden des Kirchenjahres
essen,
trinken und tun.
Sorgt sich Gott wirklich darum ob wir freitags Fleisch essen oder den
Kühlschrank während der Fastenzeit von Milchprodukten
befreien ?
Ist das wirklich wichtig ?
Zusätzlich haben manche noch Bedenken wegen der
Scheinheiligkeit, die das Fasten manchmal begleitet.
Wir weigern uns aus spirituellen Gründen manche Lebensmittel
zu essen,
tun aber wenig oder gar nichts dafür, unser Verhalten
gegenüber Anderen zu ändern.
Eine mit der Fastenzeit verbundene Klage (sowohl vom Hl. BASILIOS dem
Grossen,
wie vom Hl. CHRYSOSTOMOS überliefert und von Metropolit Simeon
von
der Bulgarischen Orthodoxen Kirche auch in unserer Zeit wiederholt
gelehrt,
Anm. des Herausgebers dieser Internet-Seite) fasst das mit
erschreckender Genauigkeit zusammen:
" DU ENTHÄLTST DICH DER FLEISCHSPEISE - ABER DU VERSCHLINGST
DEINE NÄCHSTEN !"
Der Hl.JOHANNES vom Sinai hat uns die wirkliche spirituelle Gefahr
aufgezeigt, die im übermässigen Genuss liegt:
...Essen soll den Körper gesund erhalten;
aber nicht durch un-überlegte -oft von aussen
suggerierte- Wünsche
versklaven und
uns von der Sorge um unser Heil ablenken !
Die pastoralen Erfahrungen der Kirchenväter ergänzen
die biblischen Mahnungen, wie die des Hl. Apostels PAULUS:
" ... sorgt nicht so für euren Leib, dass unsinnige Begierden
erwachen " (Röm. 13,14).
Die asketische Tradition der Alten Kirche kennt mehrere Gründe
für das Fasten.
Richtiges Fasten reinigt den Körper von Giften, es erleichtert
das Gebet,
es hilft LEIDENschaften und Versuchungen zu beherrschen,
und es hilft Solidarität mit den Armen dieser Welt zu
fühlen.
Diese Tradition aber besteht auf einem Zugang zum Fasten, der heute oft
vergessen wird:
Ausgewogenheit und Masshalten.
Wir können uns zwanghaftes "Etikettenlesen" von allen
gekauften Lebensmitteln auferlegen,
nur um sicher zu sein, dass sie auch nicht eine Spur von Milch
enthalten;
wir können hungern bis unsere Gesundheit in Gefahr ist;
wir können uns hämisch freuen über unseren
"Erfolg" und die weniger Eifrigen unter uns verurteilen.
Das aber macht die Fastendisziplin zu einer Farce.
Viele Orthodoxe, die im Westen leben, stehen vor einem Dilemma, wenn
sie von Nicht-Orthodoxen eingeladen werden,
die unsere Fastenpraxis nicht kennen, oder auch von Orthodoxen, die
sich nicht darum scheren.
In diesen Fällen sind Ausgewogenheit und Masshalten besonders
gefragt.
Um Stolz auf unser Fasten zu vermeiden, ist es gesund und
vernünftig, das Gebot zur richtigen Zeit zu lockern.
" Durch die Lockerung unserer gewöhnlichen Praxis, "
rät der Hl. DIODOKOS von Photiki,
" können wir unsere Selbstbeherrschung in Demut verborgen
halten ".
Wenn wir in Gefahr sind andere mit unseren Fasten zu beleidigen, ist
der Rat des Hl. PAULUS eine gesunde Daumenregel:
" ... esst, was euch vorgesetzt wird " (1Kor 10:27)
Doch beantwortet solcher Rat nicht die Frage, warum wir gerufen
-eingeladen- sind, Fastenregeln zu akzeptieren,
sei es eine totale Abstinenz für kurze Zeit oder
eingeschränkte Nahrung während längerer
Fastenzeiten.
Evagrios Pontikos, ein georgischer Mönch, der 399 in der
Abgeschiedenheit der ägyptischen Wüste starb,
beschreibt uns die richtigen Gründe, warum das Fasten im
christlichen Leben so wichtig ist:
" Faste vor dem Herrn so gut du kannst, " rät er,
" denn damit wirst du von deinen Lastern und Sünden gereinigt;
es erhöht die Seele,
heiligt den Geist,
treibt Dämonen aus
und bereitet dich auf die Gegenwart Gottes vor
...
Sich der Nahrung zu enthalten, sollte dann deine eigene Wahl sein und
asketisches Bemühen ".
Elias, der Presbyter, ein Priestermönch des 11./12.
Jahrhunderts,
verdeutlicht dieses Ziel mit dem Bild des kommenden Reiches.
"Wer Fasten und das unablässige Gebet praktiziert,
das eine zusammen mit dem anderen,
wird sein Ziel, die Stätte aus der ´Kummer und
Seufzen entfliehen´ (Jes 35:10 LXX) erreichen ".
Fasten dient dem Heil nur wenn es in Beziehung auf das Reich Gottes
gehalten wird.
Wenn es auch dazu dienen mag den Leib zu entgiften
und uns hilft unsere Versuchungen zu Völlerei und Genusssucht
in den Griff zu bekommen,
rechtfertigt dies keineswegs ihre Strenge.
Die Fastendisziplin hat nur einen grundlegenden Zweck: uns auf das Fest
vorzubereiten.
Wir enthalten uns völlig des Essens bevor wir die Heilige
Kommunion empfangen,
nicht nur um den Bauch zu leeren,
sondern um Hunger für die wahre Eucharistie zu schaffen,
das Himmlische Mahl, das für uns bereitet wurde vor der
Erschaffung der Welt.
Das gleiche gilt für die langen Fastenzeiten unseres
Kirchenjahres.
Sie helfen sehr bei der lebenswichtigen Aufgabe, die "Zeit zu
heiligen",
Herz und Geist der überweltlichen Wirklichkeit und dem
Versprechen der erfüllten Hoffnung zu öffnen.
Fasten hat seine wahre Grundlage im gesamten sakramentalen Leben der
Kirche,
das den Gläubigen nährt und zum ewigen Leben, zu
Freude und Frieden im Himmelreich führt.
Es erhebt uns über die täglichen Sorgen unserer
irdischen Existenz,
um uns sicher auf die Flugbahn zu setzen,
die uns von diesem Leben ins nächste bringt.
Fasten ist kein Sakrament im strikten Sinne, aber es ist zutiefst
"sakramental".
Sakramental und eschatologisch, weil es unser gegenwärtiges
Leben und unser Tun heiligt,
unser Gebet -das persönliche, wie das gemeinschaftliche-
vertieft und verstärkt,
und in unserem innersten Sein einen entscheidenden Durst nach dem
versprochenen Mahl schafft, dem kommenden ewigen Fest.
Fasten ist die Mahnung, dass der Weg zur Herrlichkeit der Weg des
Kreuzes ist.
Fasten mag kleinere Unannehmlichkeiten auferlegen:
unseren Drang nach sofortiger Befriedigung enttäuschen
und uns schmerzlich daran zu erinnern, wieviele der Menschen dieser
Erde jede Nacht hungrig zu Bett gehen.
Aber das alles hat sein Gutes.
Denn diese Unannehmlichkeiten führen den Leib, den Geist und
die Seele zu dem, was wirklich wichtig ist:
zum himmlischen Jerusalem
in dem die Seele erhöht wird,
der Geist geheiligt
und die Dämonen besiegt,
und wir alle auf ewig in der Gegenwart Gottes weilen.
Quelle: http://www.holyapostles.org
* St. Andreas Bote:
empfehlenswerte Monatsschrift in deutscher Sprache mit ausgewählten aktuellen Texten der besten Theologen aus allen orthodoxen Traditionen und aktuellem Kalendarium
Fragen, Zuschriften an G.Wolf, Dammweg 1, 85655 Grosshelfendorf, 08095 - 1217; gerhard.wolf@t-online.de
jetzt auch online !
St. Andreas Bote - online
Herr und Gebieter meines Lebens,
Gib mir nicht den Geist des Müßiggangs, des Verzagens,der Herrschsucht und der Geschwätzigkeit.
Schenke vielmehr mir, Deinem Diener, den Geist der Keuschheit, der Demut, der Geduld und der Liebe.
(еine große Verneigung)
Ja, Herr, mein König,
gewähre mir, meine Sünden zu sehen
und meinen Bruder nicht zu verurteilen,
denn gesegnet bist Du in alle Ewigkeit,
Amen.
Das Gebet des Hl. Ephraim des Syrers
1) Faulheit (Müssiggang)
Der Geist der Faulheit (man kann dieses Wort im Original sehr verschieden übersetzen) hat in erster Linie mit dem Zustand unserer Seele zu tun, wenn in ihr kein Leben ist, wenn sie so vor sich her schlummert und erkaltet ist. Er ist ein Ausdruck für Leere in uns. Es ist die Leere, die das Evangelium mit einem leeren Haus bezeichnet, aus dem der böse Geist vertrieben worden ist. Es ist aufgeräumt, sauber und bereit, Gäste zu empfangen. Und doch ist es leer. Und das Evangelium sagt weiter, wie dann der vorher vertriebene böse Geist zurückkehrt und, wenn er nun sieht, dass es sauber und aufgeräumt ist, andere sieben noch furchtbarere Geister ruft und diese sich wieder in dieses leere Haus einnisten (Mt. 12,43-45). Das ist eine Warnung an uns. Wenn unsere Seele leer ist, wenn unser Herz leer ist und unser Verstand, wenn unsere Worte leer sind, ohne Geist und Leben - das doch eigentlich Dem gehört, Den wir als unseren Herren und Gebieter bekennen - dann ergreift sie, dann erfüllt sie etwas anderes. Deshalb ist das erste, wovor uns der Herr bewahren soll, der Geist der Faulheit, der Schläfrigkeit, der Leere – wie viele Wörter bezeichnen ein dasselbe – der der Grund für jegliche Zerstörung ist.
2) Die Verzagtheit.
Wenn wir in uns diesen Zustand, den ich gerade beschrieben habe, feststellen, dann sollten wir irgendwie handeln. Dafür bedarf es Entschiedenheit und Mut. Doch wir verzagen. Es ist so einfach auf etwas Besseres zu hoffen und doch so schwer, sich von der Stelle zu rühren. Es ist viel einfacher auch weiterhin in einer Welt der Illusionen zu leben, als wirklich aufzuwachen. Doch ein wirklicher Held ist der, der aufgewacht, der von sich schüttelt alle Schläfrigkeit, wer wirklich wachsam ist. Es ist derjenige, der nach den Worten vom Heiligen Serafim von Sarow entschlossen ist, lieber seine Ruhe und alles, was ihm teuer ist, entbehren zu müssen, als ohne Gott zu leben. Darin besteht der einzige Unterschied zwischen einem Sünder, der an seiner Sünde zugrunde geht, und einem Heiligen, der seiner Berufung gerecht wird, weil er Verzagtheit und Trübsinn in sich überwindet.Trübsinn ist Schlummern sehr ähnlich. Man lässt alles laufen, wie es so geht. Man flüchtet sich lieber eine Traumwelt, in eine virtuelle Welt, in die Illusionen. Der Schlummer wartet nicht auf die Nacht. Man schließt die Augen und könnte denken, es ist Nacht und Zeit zum Schlafen. Und ist es nicht merkwürdig, dass gerade dann, wenn uns die Kraft nicht ausreicht, etwas zu tun, wir uns voller Stolz in eine Welt der Macht und des Erfolges träumen? Wenn wir aber beschäftigt sind mit einer Sache, die unsere gesamte Aufmerksamkeit erfordert, dann ist das erste, was wir uns erträumen, die Sache auch zu leiten, dann erwacht in uns der Hunger nach Macht, dann treibt uns der Stolz. Neben unserer Verzagtheit steht unsere Feigheit, stehen Schlaffheit und ein Leben in Illusionen. Und in diesen Illusionen träumen wir von Macht, von Stärke und die damit verbundene Grausamkeit und Grobheit.
3) Geschwätzigkeit.
Es geht nicht darum, dass wir viel reden. Natürlich ist auch das damit gemeint. Doch es geht vielmehr um die Nichtigkeit unserer Worte. Unsere Worte tragen keine Früchte. Diese Fruchtlosigkeit wurzelt in Verzagtheit, Trübsinn und Träumerei, die zu Machthunger führt. Und so reden wir, wenn es eigentlich nicht sein sollte und leben in unserer Phantasie, statt in der realen Welt. Dies ist sehr wichtig, denn die Welt Gottes ist die Welt der Wirklichkeit. Die Welt des Satans ist die Welt der Illusionen, die virtuelle Welt. Die Welt Gottes ist ganz real und in ihr bestehen all die Schwierigkeiten und die Grausamkeiten der realen Welt. Der Satan schlägt uns eine Welt vor, in der nichts wirklich ist, obwohl alles möglich erscheint. Wir fühlen uns dann stark. Unser Stolz ist befriedigt. Wir können uns innerlich rühmen. Wir können uns anders denken, als wir in Wirklichkeit sind. Wir sind wichtig und mutig, obwohl wir noch nichts getan haben. Wir schlafen und die wirkliche Welt gehört denen, die wach sind.So geht es in den ersten Worten des Gebets um das Allerwichtigste. Wenn ich Gott als meinen Herrn und Gebieter anerkenne, wenn ich mich bemühe, in der Wirklichkeit zu leben, wenn ich darum ringe, die dämonische Welt der Phantasie und Virtualität von mir zu stoßen, wenn ich mit allen Kräften versuche, wirklich zu leben, um dem Tod zu entkommen – denn Leben und Wirklichkeit gehen Hand in Hand, so wie der Tod zusammen mit der Illusion – dann sollte ich begreifen lernen, was konkret und ganz real diese Worte bedeuten: Sie beschrieben nicht nur einen Zustand in der Seele, sie sind vielmehr ein Programm zum Handeln, denn jedes dieser Worte sollte für uns eine Herausforderung darstellen, eine Losung, eine Devise, die uns dazu zwingt, auf bestimmte Weise zu agieren.Wie? – das verraten uns kurz die nächste Zeile: Gib mir, Deinem Knecht, vielmehr einen Geist der Keuschheit, der Demut, der Geduld und der Liebe.
4) Keuschheit ist nicht nur eng in ihrem Bezug auf unseren Leib zu verstehen, so wie auch Jungfräulichkeit nicht nur ein physischer Zustand ist. Keuschheit beginnt in dem Moment, in dem wir uns der erstrangigen Wertmaßstäbe bewusst werden und uns um sie bemühen: um Gott und um den Menschen, wenn wir in unserem Verhältnis zu Gott und zu dem Menschen (uns selbst eingeschlossen) ehrfürchtig auftreten, wenn wir unseren eigenen Leib so ehren, wie wir es mit dem Brot und Wein tun, die sich in den Leib und das Blut Christi verwandelt haben, wie wir den Leib des Mensch gewordenen Gottes verehren würden und daraus schlussfolgernd jeden ehren würden, dem wir begegnen. Keuschheit beginnt damit, dass wir begreifen, dass jeder Mensch zur Ewigkeit berufen ist, dass er wertvoll ist in den Augen Gottes, dass er das Heil erlangen aber auch ins Verderben stürzen kann. Der Mensch kann ein Objekt der Verehrung sein und wir sind dazu aufgerufen, wie Christus gesagt hat, als er Seinen Jüngern die Füße wusch, dass auch wir einander die Füße waschen, dass wir einander treu sein und einander in Demut und Liebe dienen sollten. Nur wenn wir in einem solchen Geist leben, können wir ihn im gesamten Menschen zum Blühen bringen: in der Seele, im Leib und einen solchen Zustand der Seele, des Verstandes und des Herzen erreichen, der uns zu einer völligen und ständigen Reinheit des Leibes führt, was wir dann als Keuschheit bezeichnen.
5) Demut ist etwas viel Größeres als die traurige Karikatur, die wir oft darstellen. Es scheint uns, dass Demut darin besteht, dass wir uns immer wieder einreden, keiner Beachtung durch andere würdig zu sein, obwohl wir in Wirklichkeit so nach ihr dürsten. Oder wir behaupten, dass wir etwas Unwichtiges geleistet haben, obwohl wir eigentlich wissen, dass wir etwas Gutes und Wichtiges getan haben. Es hätte aber keinen Wert, weil wir es getan haben. Das ist keine Demut. Wirkliche Demut heißt in erster Linie, sich selbst zu vergessen und sich dabei ernsthaft, tiefgreifend und kreativ um Gott und seinen Nächsten zu kümmern. So, dass wir gar kein Interesse daran haben, uns auf uns selbst zu konzentrieren. Es ist ein Zustand, in dem wir, wenn wir uns plötzlich wichtig nehmen, zu uns sagen: Geh mir aus dem Weg! Du bist kleinlich und niedrig und so uninteressant! Ich möchte mich mit sehr viel Wertvollerem beschäftigen!Demut hängt auch mit dem Sieg über unsere Sucht nach Anerkennung und über unseren Stolz zusammen.
6) Demut steht in Verbindung mit Ruhmsucht. Nicht nur, weil sie ganz offensichtlich ihr Gegenteil darstellt. Ehrsüchtig ist vielmehr der, der nach Anerkennung in den Augen der Menschen strebt, nicht aber von Gott. Wenn man aber bedenkt, von welchen Menschen wir uns Anerkennung erhoffen oder wofür wir gerne gelobt werden wollen, dann sehen wir, wie niedrig wir uns selber machen durch diese Sucht nach Anerkennung. Der Anlass für diese Ruhmsucht kann etwas sehr Unbedeutendes sein: ein Witz, ein Erfolg, der eigentlich in keinem Verhältnis zur eigentlichen Größe des Menschseins steht. Es kann sein, dass wir sogar denjenigen, die uns verachten, aber trotzdem beklatschen, noch dankbar sind für ihr Lob. In beiden Fällen, sei es nun wegen des Anlasses oder wegen der Leute, macht uns die Ehrsucht zu unwahrscheinlich kleinen, leeren Wesen, die eigentlich zu nichts Nütze sind. Sie führt uns zur Nichtigkeit. Demut beginnt vielmehr da, wenn wir anfangen, unsere Urteile nicht mit denen der Menschen zu vergleichen, mit den oberflächlichen und zufälligen Bemerkungen der Leute, sondern mit der wahren Größe des Menschseins, mit der Fülle der Wahrheit Gottes. Demut besteht darin, kein anderes Maß für sich anzunehmen, als nur die Größe des Menschseins vor dem Urteil Gottes.Das ist der Grund, warum die Heiligen demütig waren, warum sie begriffen hatte, wie groß der Mensch ist und gleichzeitig, wie weit sie selbst von ihrer Berufung entfernt waren. Denn sie wussten, dass uns die die wirkliche Größe des Menschen in Jesus Christus offenbart worden ist (Röm. 5,15). So konnten sie mit wahrer Demut sich eingestehen, wie unwürdig sie doch selbst waren. Denn sie wussten, dass Gott wollte, dass wir Seine Freunde seien, Seine engen Weggefährten. Und so konnten sie auch das ganze Ausmaß und die Tiefe unseres Falls begreifen und den Abgrund zwischen uns und Ihm ermessen und so ihrer Demut beweisen. Aus der Schau der Größe des Menschen und der Herrlichkeit Gottes wird im Menschen die Demut geboren. Nicht aber aus dem ständigen Sich Bewusstmachen der eigenen Misserfolge oder der eigenen Unwürdigkeit. Darüber habe ich schon einige Male gesprochen: Demut, im englischen humility kommt vom lateinischen Wort „humus“. Fruchtbarer Boden. Dies ist ein sehr passendes Bild. Die Erde, der Boden ist immer da. Auf ihm gehen wir und er lässt mit sich machen, was wir wollen. Er nimmt unseren Müll an, aber auch lebendigen Samen und Sonnenstrahlen und Regen. Er kann alles aufnehmen und daraus Früchte hervorbringen. Man denkt nicht an ihn. Er schweigt. Er hält alles aus und bringt doch Frucht. Darin besteht Demut.
7) Geduld ist ein anderes gehaltvolles Wort. Es ist nicht nur die Fähigkeit geduldig seinen Nächsten zu ertragen. Es ist die Fähigkeit, Leid auszuhalten, Schwierigkeiten, Einschränkungen, beliebige Lasten zu tragen, angefangen von sich selbst bis hin zum Tod am Kreuz. Geduld bedeutet Kraft, Glauben, Schweigen. Dies alles führt uns auch zur Liebe und beginnt in der Liebe. Liebe ist die Fähigkeit alles zu geben, was man hat: auch sich selbst. Es ist die Fähigkeit, den anderen voller Ehrfurcht in seinem Anderssein anzunehmen, voller Verehrung und Freude. Es ist die Fähigkeit, sein Leben für seine Freunde hinzugeben und Opfer zu bringen. Wenn hier Parallelen zu dem vorher Gesagten gezogen werden sollen – und das schlage ich euch vor, selber zu tun – kann man sehen, dass in der Liebe die Antwort auf die ersten vier Bitten enthalten ist. So lebt der, der für die Wirklichkeit erwacht ist, der vor dem Angesicht Gottes und des Menschen, vor sich selbst und vor seiner eigenen Berufung wandelt, der bereit ist, zu handeln und der all dies als Grund und als Endziel betrachtet, mit Liebe, denn sie ist die Fülle des Lebens.Und am Ende beten wir, obwohl wir damit auch hätten beginnen können, denn für Ephrem dem Syrer war dies vielleicht die gewohnteste Erfahrung des Lebens: Herr und König, lass mich meine eigenen Sünden erkennen und nicht meinen Bruder verurteilen!
Amin.
(Entnommen dem Buch: „Durch das Kirchenjahr“ von Metropolit Anthony (Bloom)
8.2.2026
Sonntag
vom Verlorenen Sohn
https://youtu.be/Ur39cbcr_pk
Apostel:
1 Kor 6: 12-20
Evangelium: Lk 15: 11-32
Vater Alexander
Schmeman:
"
Rückkehr aus dem Exil "
Die
Apostellesung dieses Herrentages stellt die christliche Freiheit heraus
und steckt damit die Grenzen des Fastengebots ab:
"Alles ist mit erlaubt, aber
ich soll mich von nichts
beherrschen lassen"
Damit ist das Fasten jeder fremden
Beurteilung von aussen entnommen. Es
kann daher nach orthodoxem Verständnis auch nicht zum
öffentlichen Gesetz werden, zumal es, wie der Herr anweist (Mt
6: 16-18) im Verborgenen geschehen soll.
Das Evangelium stellt dann den eigentlichen Sinn der Fastenzeit heraus:
Der Aufbruch zur Umkehr zum Vater, der den Verlorenen Sohn mit Freuden
aufnimmt und reich beschenkt. Es ist wohl kein Zufall, dass an diesem
Herrentag erstmals im Nächtlichen Psalmengebet (Ps 136)
angestimmt wird.
Deine
väterliche Herrlichkeit
habe ich ohne Verstand verlassen.
übel verschwendet habe ich den Reichtum
den Du mir gegeben hast.
So rufe ich Dir die Worte des Verlorenen Sohnes zu:
"Ich habe gesündigt gegen Dich,
barmherziger Vater.
Nimm mich auf,
der ich umkehre,
und lass mich bei Dir sein
wie einen Deiner Taglöhner !"
Alles, was er hat, das hat er von Gott.
Er zieht in ein gottfernes Land, liefert sich einer gottfernen Gesellschaft aus.
Er nimmt so viel er kann aus seiner Mitgift, dem Eigentum Gottes.
Er verschwendet es hemmungslos an Idole, die ihm kurzfristig faszinierend erscheinen.
Als es seine Mitgift verbraucht hatte, im Genuss des Materiellen, Innerweltlichen, tritt die Hungersnot ein. Nichts vermag ihn zu sättigen im Anblick des Absterbens seiner Lebendigkeit, niemand, keine Parole kann ihn mehr begeistern.
Keines seiner Idole kommt ihm zu Hilfe: "Ich sterbe hungers !"
Aber er hat noch die Kraft seine Niederlage einzugestehen:
"Wie viele Tagelöhner im Hause meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen".
Es ihm gleich zu tun, dazu fordert uns die Kirche auf, jetzt in der Zeit des Aufbruchs in die Grossen Fasten vor der Auferstehung.
"Ich
will mich aufmachen", ich will aufstehen, damit Überblick
gewinnen, Gewohntes verlassen
und mich auf den Weg machen,
den die Fastenzeit mir öffnet, hin zum Vaterhaus.
Das ist das Ziel: zu Gott, zu unserem Vater zu gelangen.
Er macht mich frei.
Er nährt mein innerstes Leben.
Er will mir in der Wohnung Seiner Herrlichkeit Geborgenheit auf ewig
bieten.
Wer könnte sagen, er wäre ohne Sünde: "Weil kein Mensch lebt ohne zu sündigen" (1 Könige 8: 46) ?
Es tut uns gut, wenn wir noch sagen können: "Ich habe mich versündigt an der Liebe zu Gott und den Nächsten" !
Gott umarmt uns als Seine Kinder.
Gott schützt uns mit Seiner Kleidung (in der Taufe haben wir "Christus angezogen"), der besten Kleidung, der Kleidung der Kindschaft Gottes -wenn wir uns blossgestellt fühlen, wie einst Adam.
Gott setzt uns ein, in Sein Erbe, das unverwesliche Erbe der Unsterblichkeit.
Und trotz all dieser Gaben will er unsere Freiheit: Er gibt uns den Siegelring der Freien.
Die Kirchenväter deuten es noch tiefer:
Die Schuhe weisen auf die Befähigung auf dem Weg (Christi) fortzuschreiten, das Siegel auf das Siegel des Heiligen Geistes.
Unser Vater bereitet uns das Freudenmahl -das Ostermahl, -die Göttliche Liturgie.
Auch wenn wir dem zweiten Sohne gleichen, der tief in seinen Alltag verstrickt ist, und glaubt durch äusserliche "Anständigkeit" immer im Sinne des Vaters gehandelt zu haben, und so zum Knecht seiner Selbstgerechtigkeit geworden ist, und wenn wir, wie er, nicht hineingehen wollen, um uns für das Freudenfest bereit zu machen, so sucht uns doch der Vater heim:
"Da kam sein Vater heraus, und redete ihm zu"
Hören auch wir auf Gott, unseren Vater wenn er uns durch die Tradition der Kirche jetzt in der Vorfastenzeit auf das österliche Freudenfest vorbereitet !
Ja, ich werde die Fesseln der Torheit lösen, die mir von Ihm geschenkten Reichtuemer nicht mehr mehr mit Sündern verschwenden, sondern mich aufmachen und zu meinem mitfühlenden Vater zurückkehren.
An
den Flüssen von Babylon saßen wir ...
gedenkend der Stadt des Herrn ...
Wie könnten wir dem Herr ein Lied singen
in einem fremden Land ?
Sollte ich dich vergessen, o Stadt meines Gottes,
so verdorrt meine rechte Hand
so klebt meine Zunge am Gaumen
wenn ich Deiner vergesse,
wenn ich nicht Gottes Stadt über alle meine Freuden stelle ...
"An
den Flüssen von
Babylon ..."
~~~ Na Rekach
Babylonskich ~~~
Chor des Klosters in Pyuchtiza
Erzpriester
Alexander Schmemann:
(langjähriger Dekan der Orthodoxen Theologischen Akademie der
USA St. VLADIMIR´s)
aus: Schmemann,
Alexander, GREAT LENT. Journey to Pascha,
St. Vladimir´s Seminary Press, Crestwood, New York 1969
Die Große Fastenzeit, Askese und Liturgie in der
Orthodoxen Kirche, (aus dem Englischen übersetzt von Elmar
Kalthoff)
Veröffentlichungen des Instituts
für Orthodoxe Theologie der Universität
München, Bd. 2 1994, S. 15f.
Rückkehr
aus dem Exil
zum
Sonntag vom Verlorenen
Sohn
Zusammen mit den Hymnen dieses Tages erschließt uns dieses Gleichnis die Zeit der Reue als die Rückkehr des Menschen aus dem Exil.
Ein fernes Land...Das ist die einzig zutreffende Bezeichnung für unsere Bedingtheit als Mensch, die wir annehmen und zu der unseren machen müssen, wenn wir unseren Weg zu Gott hin beginnen.
Ein Mensch, der niemals diese Erfahrung gemacht hat, und sei es auch
nur für kurze Zeit, dass er in der Gottesfeme lebt und von dem
wahren Leben abgeschnitten ist, wird niemals verstehen, was es mit dem
Christentum auf sich hat.
Und jemand, der vollständig in dieser Welt und in dem Leben
dieser
Welt »zuhause« ist, der nie von dem
sehnsuchtsvollen Wunsch
nach einer anderen Wirklichkeit schmerzlich getroffen wurde, der wird
nie verstehen, was bereuende Umkehr ist.
Man übersieht jedoch etwas sehr Wesentliches, ohne das weder das Schuldbekenntnis noch die Absolution eine wirkliche Bedeutung oder Wirksamkeit erlangen können. Dieses »Etwas« ist ganz genau das Empfinden des Verbanntseins von Gott, weit verbannt von der Freude der Gemeinschaft mit ihm und fern dem wahren Leben zu sein, das durch Gott geschaffen und geschenkt wird. Es ist in der Tat leicht zu bekennen, dass ich an den vorgeschriebenen Tagen nicht gefastet habe, dass ich meine Gebete vergessen habe oder jähzornig gewesen bin. Eine ganz andere Sache ist es jedoch, wenn ich mir unvermittelt eingestehen muss, dass ich Schande auf mich geladen und meine geistliche Schönheit verloren habe, dass ich mich sehr weit von meinem eigentlichen Zuhause, von meinem wahren Leben entfernt habe, und dass ich in dem innersten Gewebe meiner Existenz etwas Kostbares, Schönes und Reines in nicht wiedergutzumachender Weise zerstört habe. Indessen bedeutet dies, und nur dies, die bereuende Umkehr, und deshalb entsteht auch ein tiefgreifendes Verlangen, umzukehren, zurückzugehen und jenes verlorene »Heim« wiederzufinden.
Von Gott habe ich wunderbare Reichtümer erhalten:
zunächst das Leben und die Möglichkeit, mich dessen
zu erfreuen,
ihm einen Sinn geben zu können,
es mit Liebe und Erkenntnis ausfüllen zu können;
dann – in der Taufe –
das neue Leben in Christus selbst,
die Gabe des Heiligen Geistes,
den Frieden und die Freude auf das ewige Königreich.
Ich habe die Erkenntnis Gottes erhalten,
und in ihm die Erkenntnismöglichkeit einer jeden Sache,
und die Kraft, Kind Gottes zu sein.
Aber die Kirche ist da, um mich daran zu erinnern, was ich aufgegeben und verloren habe.
Und während sie mir dies ins Gedächtnis zurückruft, erinnere ich mich; so wie es das Kontakion dieses Tages ausdrückt:
»Fern von der Herrlichkeit des Vaters bin ich in meiner Torheit Fesseln umhergeirrt
und habe mit den Sündern die Reichtümer, die du mir anvertraut hattest, verschwendet.
So rufe ich mit dem verlorenen Sohn zu dir:
Barmherziger Vater, ich habe gegen dich gesündigt.
Nimm mich reuigen Sünder wieder auf und nimm mich an wie einen deiner Tagelöhner ... !« Und während ich mich erinnere, spüre ich in mir das Verlangen und die Kraft zurückzukehren:
»... Ich werde mich aufmachen und zu meinem mitfühlenden Vater zurückkehren
und werde zu ihm unter Tränen sagen:
Nimm mich auf wie einen deiner Diener! «
In diesem Sinne singen wir heute den sehnsuchtsvollen Psalm 136:
An
den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten,
Sions gedenkend...
Wie könnten wir dem Herrn ein Lied singen, in einem fremden
Land?
Sollte ich dich, o Jerusalem, vergessen, soll meine Rechte verdorren!
Meine Zunge klebe an meinem Gaumen, wenn ich deiner vergesse,
wenn ich nicht Jerusalem über alle meine Freuden stelle ...
Erzpriester
Alexander Schmemann:
(langjähriger Dekan der Orthodoxen Theologischen Akademie der
USA St. VLADIMIR´s)
aus: Schmemann,
Alexander, GREAT LENT. Journey to Pascha,
St. Vladimir´s Seminary Press, Crestwood, New York 1969
Die Große Fastenzeit, Askese und Liturgie in der
Orthodoxen Kirche, (aus dem Englischen übersetzt von Elmar
Kalthoff)
Veröffentlichungen des Instituts
für Orthodoxe Theologie der Universität
München, Bd. 2 1994, S. 15f.
"An den Flüssen von
Babylon ..."
~~~ Na Rekach Babylonskich ~~~
Chor des Klosters in Pyuchtiza
2.
FEBRUAR / 15. 2.
Fest
der
Begegnung unseres Herrn
bei Seiner Darstellung im Tempel
mit dem gerechten Greis Simeon und der Prophetin Anna
~ SRETENIE
~ ~
YPAPANTI
~ ~
INTAMPINAREA DOMNULUI ~
Rette,
Sohn Gottes,
getragen auf den Armen
des gerechten Simeon,
uns,
die wir Dir singen:
Alleluja !
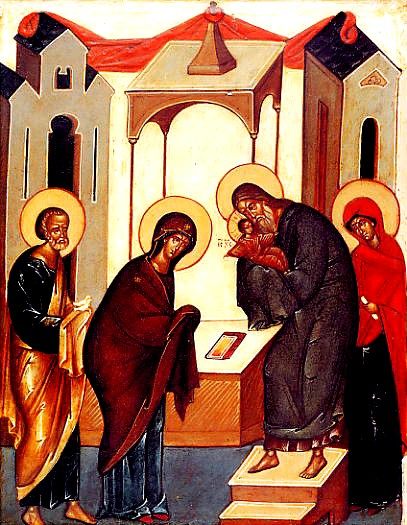
Heiser,
Lothar: zur Bedeutung von Fest und Ikone
Hl.ROMANOS
der MELODE:
Kontakion
zum Fest
Stichira
der Nachfeier
Nach
CHRISTI GEBURT und THEOPHANIE ist das Fest der Begegnung unseres Herrn
bei Seiner Darstellung im Tempel das dritte Hochfest der Menschwerdung
und des Kommens des Gottessohnes im Fleische in unsere Welt.
Die Begegnung des Herrn mit Simeon, dem gerechten Greis und Anna, der
alten Prophetin, ist zugleich:
- Symbol der Begegnung des Heils des Neuen Bundes mit dem Alten Bund,
am Ende seiner Jahre.
(Tatsaechlich endete mit der Festigung des
christlichen Gottesdienstes der Tempeldienst im Jerusalemer Tempel ein
fuer alle mal.)
- Erkenntnis der Begegnung der im Gottssohn wiederhergestellten
menschlichen Natur mit der durch Suenden gealterten Menschheit
- Heilbringende Begegnung fuer die einzelne Menschenseele, der die
Hoffnung bereits lange erstorben war, dass sie jetzt das neue Leben
empfängt.
In dieser Begegnung wird der menschlichen Natur Erneuerung, Heilung und
Wiederherstellung der Ergöttlichung zuteil.
Dieses
Fest ist schon durch die roemische Pilgerin Aetheria in
Jerusalem um die Wende vom 4. zum 5. Jahrhundert bezeugt und hat sich
von dort aus in der gesamten Weltkirche verbreitet.
Freue dich,
gnadenerfuellte, jungfraeuliche
Gottesgebaererin !
Denn aus dir ist aufgestrahlt
die Sonne der Gerechtigkeit,
CHRISTUS unser GOTT.
Er erleuchtet
die sich bisher bewegten in Finsternis.
Frohlocke auch du,
gerechter Greis,
der du
den Befreier unserer Seelen auf den Armen traegst,
der uns auch die Auferstehung schenkt.
+++
Nun entlaessest Du, Herr, nach Deinem Worte
Deinen Knecht in Frieden.
Denn meine Augen haben gesehen Dein Heil,
das Licht zur Erleuchtung der Heiden,
das Licht zur Verherrlichung Deines Volkes.
+++
Heiser,
Lothar:
Maria
(Die Gottesmutter)
in der
Christus-Verkündigung des orthodoxen Kirchenjahres
wird heute nach dem Gesetz in den heiligen Tempel getragen
und nimmt seinen Thron auf den Armen des Greises ein. Von Josef nimmt er als gottgefälliges Geschenk im Turteltaubenpaar die unbefleckte Kirche an,
das neuerwählte Volk aus den Heiden,
und die 2 jungen Tauben,
da Er des Alten und Neuen Bundes Begründer ist. Symeon, der die Erfüllung der an ihn ergangenen Verheißung erlangt,
segnet die Jungfrau, die Gottesgebärerin Maria,
und weist hin auf die Sinnbilder des Leidens Dessen, der aus ihr geboren wurde. Von Ihm erbittet er die Entlassung mit den Worten:
Nun entlässt Du mich, Gebieter,
wie Du mir verheißen hast.
Denn Dich habe ich geschaut,
das vorzeitliche Licht, den Retter,
den Herrn des Volkes, der Christen.
Idiomelon des Andreas von Kreta am Vorabend zum 2. Februar; Menaion, Februar
Heiser,
Lothar:
Maria in der Christus-Verkündigung des orthodoxen
Kirchenjahres,
Tyciak, Julius † und Nyssen, Wilhelm † (Hsgb.)
Sophia, Quellen östlicher Theologie, Bd. 20, Trier 1981, S.
256 f.
Hl.
ROMANOS der Melode:
Quelle
Kontakion
auf den EMPFANG UNSERES
HERRN
Groß und voll des Ruhmes bist Du,
den der Höchste im Verborgenen zeugte,
allheiliger Sohn Marias.
Einen nenne ich Dich,
zugleich sichtbar und unsichtbar,
fassbar und unfassbar,
der Natur nach als Gottessohn vor aller Zeit
erkenne ich Dich und glaube an Dich,
doch bekenne ich,
dass Du auch übernatürlich der Sohn der Jungfrau bist.
Deshalb wage ich es,
Dich wie eine Lampe zu halten;
denn jeder, der eine Lampe trägt, wird erleuchtet, nicht verbrannt.
Daher erleuchte mich, Du unverlöschliche Lampe, Du
Dies vernahm die unbefleckte Jungfrau,
von Unruhe erfasst trat sie näher,
der Greis aber sprach zu ihr:
Alle Propheten haben deinen Sohn verkündet,
den du ohne Zeugung gebarst.
Dich meinte der Prophet,
als er ihnen jubelnd das Wunder verkündete,
dass du die verschlossene Pforte bist, o Gottesgebärerin:
Durch dich trat ja der Herr ein und wieder heraus;
und weder geöffnet noch auch nur bewegt wurde deiner Keuschheit Pforte,
welche Er allein durchschritt und heil bewahrte, Er,
Von Christus bestärkt,
verkünde ich dir,
dass hieraus ein Zeichen des Widerspruches entstehen wird.
Dies Zeichen aber wird das Kreuz sein,
welches die Gesetzesfeinde Christus errichten werden.
Den Gekreuzigten werden die einen als Gott verkünden,
die anderen wiederum als Menschen,
indem diese die Glaubenssätze der Gottlosigkeit,
jene aber die der Gottesfurcht vorbringen.
Für himmlisch halten die einen seinen Leib,
die anderen für Trug;
Fleisch habe Er unbeseelt von dir angenommen, sagen sie,
die anderen: beseelt – Er,
Solche Widersprüche wird das Geheimnis hervorrufen,
dass selbst deinem Verstande Zweifel kommen werden.
Und wenn du dann deinen Sohn ans Kreuz genagelt siehst, Makellose,
wirst selbst du, obgleich der Worte eingedenk, die der Engel sprach,
plötzlich an der göttlichen Empfängnis und den unsagbaren Wundern zweifeln.
Wie ein Schwert wird dich der Widerstreit des Leides treffen;
doch danach wird er als schnelle Heilung deinem Herzen
und seinen Jüngern den unbesiegbaren Frieden aussenden, Er,
" Mit der Seele Augen sah er deines Lichtes Zeichen "
Romanos der Melode
Hymnen des orthodoxen Kirchenjahres
(Wien 1996)
hier aus St.Andreas Bote
Stichirion
Quelle
aus dem
Vespergottesdienst der
Nachfeier am 3.Februar
Der Alte der Tage (Dan 7,9),
der das Gesetz einst auf dem Sinai dem Mose übergab,
wird heute als Kind geschaut.
Nach dem Gesetz,
obwohl des Gesetzes Schöpfer,
erfüllt er das Gesetz.
Er wird in den Tempel getragen
und dem Greis übergeben.
Ihn empfängt Simeon, der Gerechte;
und da er der Anordnungen Erfüllung gekommen sieht,
ruft er voller Freude:
Geschaut haben meine Augen das seit Ewigkeit verborgene Geheimnis,
welches am Ende dieser Tage offenbar wurde,
das Licht, das der ungläubigen Völker Dunkelheit erhellt,
und den Ruhm des neuerwählten Israel.
Deshalb entlasse Deinen Diener
aus den Fesseln dieses leiblichen Daseins
in das junge und wunderbar unvergängliche Leben,
da Du der Welt das grosse Erbarmen gewährst.
3. Februar, Anthologion I, 1586
Lothar Heiser:
QUELLEN der FREUDE, Die Hochfeste der orthodoxen Christen
(Verlag Fluhegg 2002)
CH-6442 Gersau
ISBN 3-909103-19-7
1.2. 2026
Sonntag
vom Zöllner und Pharisäer
Apostel:
2 Tim 3:
10-15
Evangelium: Lk 18: 10-14
Das Evangelium macht aber sofort deutlich, dass damit nicht ein gesetzlicher Konservatismus gerechtfertigt werden soll:
Der Pharisäer, der getreu alle überkommenen Vorschriften einhält, und sich dessen vor Gott rühmt, wird beschämt durch den ausserhalb des Gesetzes stehenden Zöllner, der in Demut seine Unwürdigkeit bekennt.
Am ersten Vorfastensonntag werden wir auf die erste Voraussetzung dafür hingewiesen, dass die kommende Fastenzeit für uns heilsam wird:
DEMUT
Lasset
uns fliehen
die hochmütige Prahlerei des Pharisäers
und lernen
das demütige Seufzen des Zöllners !
Zu unserem Erlöser lasset uns rufen:
Vergib uns,
Allerbarmer !
- als solche, die kommen zur wahren Verwirklichung dessen, wozu wir berufen sind
- oder als solche, die in den "Naturgesetzen" ihrer Umgebung verfangen sind - und so das eigentliche Ziel ihres Lebens verfehlen.
"Er betet bei sich selbst: ich danke Dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen"
Er "steht von Ferne und wagt es nicht, seine Augen gen Himmel zu erheben". Er weiss um die Distanz zur erhabenen, ganz anderen Wirklichkeit des über alles erhabenen, allerhöchsten Gottes über jeden Gott, DEN, zu dem sich der selbstgerechte Mensch selber machen wollte. Er weiss um seine Schulden, die Sünden und "klopft an s e i n e Brust", nicht an die Brust der anderen um andere für deren Vergehen zu tadeln. Er weiss, das sein Schöpfer auch sein ihn liebender Erlöser ist, der ihm sogar an seiner göttlichen Natur Anteil geben will. Der sich selbst richtig einschätzende Zöllner (= der Sünder par excellence), e r b i t t e t das Erbarmen Dessen, Der die Liebe ist:
"Gott, gewähre mir Deine Gnade !"
“Gott,
sei mir Sünder gnädig!“
Predigt zum Sonntag des Zöllners und
Pharisäers von P. Konstantinos, München
* Quellenhinweis *
Die heutige
Evangeliumsperikope zeigt uns zwei Arten von
Gläubigen; zwei charakteristische Typen von Menschen, die in
die
Kirche kommen. Der erste kommt, um sich zu zeigen, um anzugeben, um
sein angeblich so heiliges Leben vorzustellen, um die Bewunderung der
anderen zu erregen, um Gott, seiner Ansicht nach, zu verpflichten
für seine Taten, für seine Tugenden, die der
Bewunderung und
des Lohnes würdig sind.
Ich möchte nicht länger bei der Charakterisierung und Beschreibung dieser Art von Menschen verbleiben. Ich möchte, dass wir uns etwas mehr Gedanken machen über eine andere Art, nämlich über jenen, den der Pharisäer verachtet, auf den er mit dem Finger zeigt und über den er schlecht redet.
Es waren dies seine einzigen Worte, aber sie kamen tief aus seinem Herzen. Worte der Reue und Buße, die zeigten, dass in dieser Brust seine Seele litt und eine geistige Geburt, eine seelische Wiedergeburt möglich wird. In diesem Kampf in seiner Brust stürzte der Zöllner den Sünder in sich vom Sockel seiner Geldgier und legte den Grundstein für ein neues Leben. Das ist das Werk der Buße. Als der Zöllner zu bereuen begann, erfuhr er die erste Frucht dieser Tugend: die Demut.
Man sagt, dass die Demut die Tugend der Alten und der Weisen sei. Aber auch der Zöllner zeigte sich demütig. Ganz hinten im Tempel klopfte er sich an die Brust und sagte: „Gott, sei mir Sünder gnädig!“ Seht seine große Demut, ganz spontan kamen ihm diese Worte über seine Lippen. Und diese Worte waren nicht von der satten Arroganz der dürren Worte des Pharisäers.
Die aufrichtige Reue des Zöllners führte ihn zur Demut, welche „die beste der Tugenden ist“, wie uns der hl. Augustinus sagt, und diese führt uns weiter zum Gebet, das eine „Kraftreserve“ ist, wie es ein anderer Denker ausdrückte. Die Tradition überliefert uns, dass König David, als er seine übergroße Sünde bereute, bitterlich weinte, wie es der 50. Psalm beschreibt, den wir in vielen Andachten unserer Kirche lesen. Aus den Tränen Davids wuchsen aus der Erde zwei Bäume: eine Weide, die auf immer trauert und eine Zeder, deren Harz sich in Weihrauch verwandelt.
Tatsächlich Quellen aus der aufrichtigen Reue zwei Tugenden: die Demut, die der Weide gleicht, die ihre Zweige nach unten neigt und das Gebet, das wie Weihrauch zum himmlischen Altar Gottes aufsteigt.
Das ist die Dreiheit der Tugenden - Reue und Buße, Demut, Gebet -, die uns heute das Triodion der Zerknirschung in Erinnerung bringt. Das Triodion, das heute beginnt, ist die Zeit, die uns auffordert, uns auf diese Tugenden zu besinnen. Jeder Sonntag des Triodions erinnert uns an eine andere Tugend. Die Kette unserer Tugenden verbindet uns mit dem gütigen Gott.
Selig
werden sein,
die in der heutigen Zeit der Gleichgültigkeit im Glauben, ja
seiner Ablehnung,
es zustande bringen,
sich durch dieses Band mit Jenem zu verbinden,
der den Zerknirschten und Demütigen im Geiste nahe ist.
Amin.
Übersetzung aus dem Griechischen: G. Wolf
30.
JANUAR / 12. 2.
Gedaechtnis
der grossen 3 Hl.
Theologen
der Weltkirche
~ 3 SVETITELI
~
~ 3 IERARCHON
~
~ SFINTII TREI IERARHI ~
BASILIUS der Grosse
GREGOR der Theologe
JOHANNES Chrysostomus
("Mund goldener Worte")
|
+++ Im Leben habt Ihr den Aposteln nachgeeifert und den Erdkreise gelehrt, fleht zum Gebieter des Alls, dass Er Frieden gewaehre unserer Welt und unseren Seelen das grosse Erbarmen ! +++ |
|
- in bekennendem, klarem und erleuchtendem theologischem Denken der Kirchenvaeter,
- in asketischem Mut und asketischer Kraft der Moenche
und letztlich in der Krone des Martyriums als Thorheit vor der momentanen Umwelt aber Triumph in der Ewigkeit.
Dies soll uns verdeutlichen, dass fuer die Kirche "Klarheit im Denken" und "Leben in der Liebe" untrennbar zusammengehoert.
WAHRE THEOLOGIE ist nicht bloss "Wissenschaft" sondern WEISHEIT, die gelebt werden will.
So wird auch jeder Christ aufgerufen und gestaerkt im Bemuehen zu seinem Heil stets Wissen mit Glauben und Leben in der Liebe zu vereinen.
Die 3 groessten Gestirne
der dreisonnigen Gottheit,
lasset uns gemeinsam
ruehmen in Hymnen,
da sie den Erdkreis
mit dem Abglanz
der goettlichen Lehren erfuellten,
die honigfliessenden Stroeme wahrer Weisheit,
die die ganze Schoepfung
mit den Wogen der Gotteserkenntnis ueberfluteten,
BASILIUS, der Grosse
GREGOR, der Theologe
und der ruhmreiche JOHANNES
mit der goldredenden Zunge
da sie fuer uns
zur allheiligen Dreieinheit flehen
allezeit !
AUFERSTEHUNGS - Nacht
11./12.4. 2026
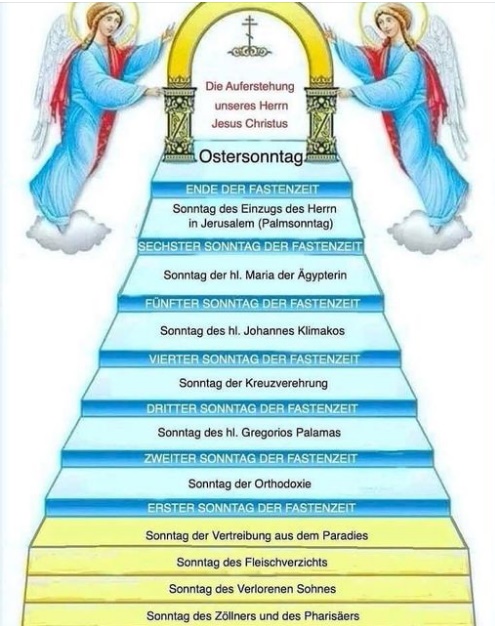
VOR - FASTENZEIT
"Der
UMKEHR Türen öffne mir ..."
~~~
Komponist: Artemij WEDEL /// Interpretation: F.TSCHALJAPIN mit Chor der
Russischen Orthodoxen Kathedrale Paris 1932 ~~~
zur Link-Quelle: "http://www.musicarussica.com"
~~~vollständig:Chor der
Christi-Verklärungskathedrale, Moskau /Regent Vladimir LVOV~~~
zur Link-Quelle: "http://en.liturgy.ru/zvuk/zvuk.php"
SONNTAGE der
VOR-FASTENZEIT
1. Sonntag vom
ZÖLLNER
und PHARISÄER
1.2.
2026
2. Sonntag vom
VERLORENEN
SOHN
8.2.
2026
3. Sonntag FLEISCHENTSAGUNG
!
vom GERICHT
15.2.
2026
4. Sonntag BUTTERENTSAGUNG
!
vom VERLUST des PARADIESES VERGEBUNGSSONNTAG
22.2.
2026
- abends:
BEGINN der GROSSEN 40-taegigen FASTEN
Vor - Fastenzeit
Weil die Kirche mit ihrer 2000-jährigen Erfahrung ein tiefes psychologisches Mitgefühl mit der menschlichen Natur entwickelt hat. Sie kennt unseren Hang uns von den Oberflächlichkeiten unserer Umwelt einnehmen zu lassen und unsere mangelnde Konzentrationsfähigkeit auf die geistlichen Güter. Ein rascher Wandel unserer Alltäglichkeit, ein unvermitteltes Hinüberwechseln in eine noch nie auch nur erspürte Praxis birgt die Gefahr uns zu überfordern. Wir dürfen nicht Wunder fordern, sondern wir bereiten uns auf immer wieder neue Anstrengungen vor. Wir müssen uns darauf vorbereiten, nach jedem Fall niemals die Anstrengungen des Aufstehens zu scheuen, wieder an die Türen der Umkehr zu klopfen und uns wieder auf den Weg zu machen.
Dieser Mut und die Bereitschaft das Ringen auch durch Entbehrungen durchzuhalten ist besonders für die Zeit der Grossen 40-tägigen Fasten notwendig. Das aktive, bewusste Fasten ist ein deutliches Bekenntnis zur Möglichkeit der Überwindung der "animalischen Naturgesetze" und ein Zeichen der Bereitschaft zu wahrer Menschlichkeit im Ebenbilde Gottes.
Wenn wir dies Bedenken, dann wird uns das Fasten nicht als unliebsame Einengung erscheinen. Wir werden erkennen das Fasten nichts mit Trübsinn zu tun hat, sondern mit Freude die Gelegenheit zur Erneuerung des Lebens ergreifen.
Deshalb wollen wir das Fasten nicht nur als
äusserliche
Übung
der "Gesetzestreue" sehen, sondern als Gelegenheit uns dem Heil der
Vergöttlichung zu nähern:
Beginnend mit der Bitte, dass sich auch
für uns die
"TÜREN der UMKEHR" öffnen mögen !
Diese Zeit soll genutzt werden, um uns zu Besinnen, uns zu überlegen und wenn möglich mit dem Beichtvater abzusprechen in welcher Weise wir am Fasten der Kirche in unseren konkreten Lebensumständen teilhaben können. Realistischerweise wird uns nämlich ausser in Klöstern die genaue Einhaltung aller Fastenregeln der Kanones (kat´akrib ei an) nicht so ohneweiteres möglich sein. Gleichzeitig wird ein am Sinn und nicht nur am Buchstaben orientiertes Fasten auch weitgehenden Verzicht auf die Genussmittel, Süssigkeiten, Fernsehen und andere "Suchtmittel" unserer Zeit bedeuten. Dies vor allem, um frei zu werden, die "Lebensqualität" eines inneren geistlichen Lebens für uns neu zu entdecken und zu intensivieren.
Die Vorfastenzeit bietet Gelegenheit zur konkreten Planung dieser Umkehr. Aus praktischer Erfahrung ist es auch empfehlenswert die Umsetzung der Pläne "austesten", um für die 40 Tage nur Vorsätze zu fassen, die wir dann auch weitgehend umsetzen können.
Wichtig ist es aber auch, sich auch gleich darauf vorzubereiten, dass wir nach jedem Fall auch wieder bereit sind aufzustehen - und das "Rennen" fortzusetzen. Nicht umsonst werden wir auch an die 40 Jahre erinnert, in denen das Volk des Herrn auf dem Weg durch die Wüste die neu gewonnene Freiheit erprobte:
- aber auch immer wieder durch Gottes Gnade und menschliche Anstrengung wieder versöhnt mit dem Schöpfer des Lebens.
ER will uns nie vernichtend strafen, sondern wie es uns Christus während Seiner 40 Tage in der Wüste gezeigt hat, immer wieder für uns und unsere Erlösung mit dem Satan, dem Versucher, ringen. Wir können darüber umso mehr Freude empfinden, je öfter wir nach unseren Sündenfällen wieder aufstehen und den Kampf wieder aufnehmen.
"Nur vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und nur ihm allein dienen" (Lk 4,8) erinnert uns der Apostel an dieses Privileg der "Synergie", der Einladung Gottes an uns, unsere begrenzten Kräfte mit Seiner Allmacht zu verbinden.
Bereiten wir uns auf die freudebringenden
Anstrengungen dieses Kampfes
vor, um dann nach der "Vollendung der 40 Tage" auch mit wenigstens
teilweise verdienter Freude die Früchte der Auferstehung
ernten zu
dürfen !
~~~ Komponist: Artemij WEDEL /// Interpretation durch grossen Chor ~~~
www.musicarussica.com - RealAudio
Der Umkehr Pforten öffne mir,
Du, Der Du das Leben schenkst !
...
Denn durch schändliche Sünden habe ich meine Seele befleckt
und mein Leben in Nachlässigkeit vergeudet.
...
In Deiner Güte mache mich rein
durch Deine huldvolle Milde !
~~~vollständig:Chor der Christi-Verklärungskathedrale, Moskau /Regent Vladimir LVOV~~~
aus: "http://en.liturgy.ru/zvuk/zvuk.php"
1.2. 2026
Sonntag
vom Zöllner und Pharisäer
Apostel:
2 Tim 3:
10-15
Evangelium: Lk 18: 10-14
Das Evangelium macht aber sofort deutlich, dass damit nicht ein gesetzlicher Konservatismus gerechtfertigt werden soll:
Der Pharisäer, der getreu alle überkommenen Vorschriften einhält, und sich dessen vor Gott rühmt, wird beschämt durch den ausserhalb des Gesetzes stehenden Zöllner, der in Demut seine Unwürdigkeit bekennt.
Am ersten Vorfastensonntag werden wir auf die erste Voraussetzung dafür hingewiesen, dass die kommende Fastenzeit für uns heilsam wird:
DEMUT
Lasset
uns fliehen
die hochmütige Prahlerei des Pharisäers
und lernen
das demütige Seufzen des Zöllners !
Zu unserem Erlöser lasset uns rufen:
Vergib uns,
Allerbarmer !
- als solche, die kommen zur wahren Verwirklichung dessen, wozu wir berufen sind
- oder als solche, die in den "Naturgesetzen" ihrer Umgebung verfangen sind - und so das eigentliche Ziel ihres Lebens verfehlen.
"Er betet bei sich selbst: ich danke Dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen"
Er "steht von Ferne und wagt es nicht, seine Augen gen Himmel zu erheben". Er weiss um die Distanz zur erhabenen, ganz anderen Wirklichkeit des über alles erhabenen, allerhöchsten Gottes über jeden Gott, DEN, zu dem sich der selbstgerechte Mensch selber machen wollte. Er weiss um seine Schulden, die Sünden und "klopft an s e i n e Brust", nicht an die Brust der anderen um andere für deren Vergehen zu tadeln. Er weiss, das sein Schöpfer auch sein ihn liebender Erlöser ist, der ihm sogar an seiner göttlichen Natur Anteil geben will. Der sich selbst richtig einschätzende Zöllner (= der Sünder par excellence), e r b i t t e t das Erbarmen Dessen, Der die Liebe ist:
"Gott, gewähre mir Deine Gnade !"
“Gott,
sei mir Sünder gnädig!“
Predigt zum Sonntag des Zöllners und
Pharisäers von P. Konstantinos, München
* Quellenhinweis *
Die heutige
Evangeliumsperikope zeigt uns zwei Arten von
Gläubigen; zwei charakteristische Typen von Menschen, die in
die
Kirche kommen. Der erste kommt, um sich zu zeigen, um anzugeben, um
sein angeblich so heiliges Leben vorzustellen, um die Bewunderung der
anderen zu erregen, um Gott, seiner Ansicht nach, zu verpflichten
für seine Taten, für seine Tugenden, die der
Bewunderung und
des Lohnes würdig sind.
Ich möchte nicht länger bei der Charakterisierung und Beschreibung dieser Art von Menschen verbleiben. Ich möchte, dass wir uns etwas mehr Gedanken machen über eine andere Art, nämlich über jenen, den der Pharisäer verachtet, auf den er mit dem Finger zeigt und über den er schlecht redet.
Es waren dies seine einzigen Worte, aber sie kamen tief aus seinem Herzen. Worte der Reue und Buße, die zeigten, dass in dieser Brust seine Seele litt und eine geistige Geburt, eine seelische Wiedergeburt möglich wird. In diesem Kampf in seiner Brust stürzte der Zöllner den Sünder in sich vom Sockel seiner Geldgier und legte den Grundstein für ein neues Leben. Das ist das Werk der Buße. Als der Zöllner zu bereuen begann, erfuhr er die erste Frucht dieser Tugend: die Demut.
Man sagt, dass die Demut die Tugend der Alten und der Weisen sei. Aber auch der Zöllner zeigte sich demütig. Ganz hinten im Tempel klopfte er sich an die Brust und sagte: „Gott, sei mir Sünder gnädig!“ Seht seine große Demut, ganz spontan kamen ihm diese Worte über seine Lippen. Und diese Worte waren nicht von der satten Arroganz der dürren Worte des Pharisäers.
Die aufrichtige Reue des Zöllners führte ihn zur Demut, welche „die beste der Tugenden ist“, wie uns der hl. Augustinus sagt, und diese führt uns weiter zum Gebet, das eine „Kraftreserve“ ist, wie es ein anderer Denker ausdrückte. Die Tradition überliefert uns, dass König David, als er seine übergroße Sünde bereute, bitterlich weinte, wie es der 50. Psalm beschreibt, den wir in vielen Andachten unserer Kirche lesen. Aus den Tränen Davids wuchsen aus der Erde zwei Bäume: eine Weide, die auf immer trauert und eine Zeder, deren Harz sich in Weihrauch verwandelt.
Tatsächlich Quellen aus der aufrichtigen Reue zwei Tugenden: die Demut, die der Weide gleicht, die ihre Zweige nach unten neigt und das Gebet, das wie Weihrauch zum himmlischen Altar Gottes aufsteigt.
Das ist die Dreiheit der Tugenden - Reue und Buße, Demut, Gebet -, die uns heute das Triodion der Zerknirschung in Erinnerung bringt. Das Triodion, das heute beginnt, ist die Zeit, die uns auffordert, uns auf diese Tugenden zu besinnen. Jeder Sonntag des Triodions erinnert uns an eine andere Tugend. Die Kette unserer Tugenden verbindet uns mit dem gütigen Gott.
Selig
werden sein,
die in der heutigen Zeit der Gleichgültigkeit im Glauben, ja
seiner Ablehnung,
es zustande bringen,
sich durch dieses Band mit Jenem zu verbinden,
der den Zerknirschten und Demütigen im Geiste nahe ist.
Amin.
Übersetzung aus dem Griechischen: G. Wolf
Evangelium:
Lk 19: 1-10
Heute hören wir die erste
Ankündigung, empfangen
die erste Einladung das Oster-Mysterium für uns heilbringend
mitzuerleben:
Wenn unser Verlangen hinreichend tief und stark ist, wird Christus
darauf antworten.
Deshalb müssen wir danach brennen den
Gottessohn, den erneuerten perfekten Menschen des Paradieses erkennen
zu lernen.
Dazu muss der Durst und der Hunger nach dem Absoluten in uns steigen,
und durch Ihn die wahrhaftige Erkenntnis in uns selbst.
(zum Sonntag des Zachäus)
Lange vor dem eigentlichen Beginn der Fastenzeit kündigt die Kirche ihr Nahen an und lädt uns ein, in die Periode einer der Fastenzeit vorhergehenden Vorbereitung einzutreten. Es ist ein charakteristischer Zug der Orthodoxen liturgischen Tradition, dass jedes Hochfest oder jeder liturgische Zeitabschnitt - Ostern, Weihnachten, Fastenzeit etc. - angekündigt und im voraus »vorbereitet« wird. Warum? Weil die Kirche ein tiefes psychologisches Gespür für die menschliche Natur hat. Da sie unsere mangelnde Konzentrationsfähigkeit und den erschreckenden Hang zur »Weltlichkeit« unseres Lebens kennt, weiß sie um unsere Unfähigkeit zu einem raschen Wandel, zu einem unvermittelten Hinüberwechseln von einem geistlichen oder geistigen Zustand in einen anderen. Deshalb lenkt die Kirche bereits lange vor dem Beginn des der Fastenzeit eigenen Bemühens unsere Aufmerksamkeit auf die ernsthafte Bedeutung dieser Zeit und lädt uns ein, deren Sinn betrachtend zu bedenken. Vor dem praktischen Vollzug der Fastenzeit wird uns deren Bedeutung gegeben.
Diese Vorbereitung umfasst fünf aufeinander folgende Sonntage,
die
der Fastenzeit vorangehen, und von denen jeder - durch sein eigenes
Evangelium - einem grundsätzlichen Gesichtspunkt der Reue
gewidmet
ist.
Der aller erste Hinweis auf die Fastenzeit erfolgt an dem Sonntag, an
dem das Evangelium über Zachäus (Lk 19,1-10) gelesen
wird. Es
ist der Bericht über einen Menschen, der zu klein ist, um
Jesus
sehen zu können, der aber so sehr von dem Wunsch beseelt ist,
ihn
zu sehen, dass er auf einen Baum steigt. Wegen seines brennenden
Verlangens wendet Christus sich ihm zu und kehrt bei ihm ein. So ist
das Thema dieser ersten Ankündigung das brennende
Verlangen. Der
Mensch folgt seinem brennenden Verlangen. Man kann sogar sagen, dass
der Mensch Verlangen ist, und diese grundlegende psychologische
Wahrheit über die menschliche Natur wird durch das Evangelium
bestätigt: »Da,
wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein« (Mt
6,21; Lk 12,34), sagt Christus. Ein heißes Verlangen
überwindet die natürlichen Grenzen des Menschen; wenn
er
leidenschaftlich etwas wünscht, kann er Leistungen
vollbringen, zu
denen er »normalerweise« nicht fähig ist.
Obwohl
»klein« von Gestalt, wächst er
über sich hinaus
und übertrifft sich selbst. Die einzige Frage ist also, ob es
die
wahren Güter sind, die wir begehren, und ob die
Stärke
unseres Verlangens auf das wahre Ziel ausgerichtet ist oder ob, um die
Formulierung des atheistischen Existentialisten Jean-Paul Sartre zu
gebrauchen, der Mensch eine »unnütze
Leidenschaft« ist.
Das ist also die erste Ankündigung, die erste Einladung: wir müssen begehren, was das Tiefste und Wahrhaftigste in uns selbst ist, den Durst und den Hunger nach dem Absoluten in uns wiedererkennen, das, ob wir es nun kennen oder nicht, uns mit einer wahrlich »unnützen Leidenschaft« behaftet sein ließe, wenn wir uns von ihm abwenden und unsere Wünsche anderswohin lenken würden. Und wenn unser Verlangen hinreichend tief und stark ist, wird Christus darauf antworten.
aus: Schmemann, Alexander, GREAT LENT. Journey
to Pascha, St.
Vladimir´s Seminary Press, Crestwood, New York 1969
Die Große Fastenzeit, Askese und Liturgie in der Orthodoxen
Kirche, (aus dem Englischen übersetzt von Elmar Kalthoff)
Veröffentlichungen des Instituts für Orthodoxe
Theologie der Universität München, Bd. 2 1994, S. 15f.
Vor österliche
FASTENZEIT
Fasten-Hirtenbrief 2007 des Oekumen. Patriarchen BARTHOLOMAIOS: "...Zeit der Geistlichen Kaempfe"
Fasten-Hirtenbrief 2004 des Oekumen. Patriarchen BARTHOLOMAIOS: „Öffne mir, Lebensspender, das Tor zur Umkehr!“
Fasten-Hirtenbrief 2004 der Orthodoxen Bischoefe Deutschlands
Beten und Fasten - Erzbischof STYLIANOS von Australien
» ... sondern nur durch Beten und Fasten« (Erzpr. Prof. Alexander Schmemann (+ 1983)
"Die
Tueren zur Umkehr, oeffne mir, Lebensspender ! ..."
~~~ Komponist: Artemij
WEDEL /// Interpretation: F.TSCHALJAPIN mit Chor der Russischen
Orthodoxen Kathedrale Paris 1932 ~~~
zur Link-Quelle: "http://www.musicarussica.com"
Vorbereitende Sonntage:
Sonntag vom ZACHÄUS 25.1. 2026
(Sonntag von der KANAANÄERIN )
Sonntag
vom ZACHÄUS
Evangelium:
Lk 19: 1-10
Heute hören wir die erste
Ankündigung, empfangen die erste
Einladung das Oster-Mysterium für uns heilbringend
mitzuerleben:
Wenn unser Verlangen hinreichend tief und stark ist, wird Christus
darauf antworten.
Deshalb müssen wir danach brennen
den Gottessohn, den erneuerten perfekten Menschen des
Paradieses erkennen zu lernen.
Dazu muss der Durst und der Hunger nach dem Absoluten in uns steigen,
und durch Ihn die wahrhaftige Erkenntnis in uns selbst.
(zum Sonntag des Zachäus)
Lange vor dem eigentlichen Beginn der Fastenzeit kündigt die Kirche ihr Nahen an und lädt uns ein, in die Periode einer der Fastenzeit vorhergehenden Vorbereitung einzutreten. Es ist ein charakteristischer Zug der Orthodoxen liturgischen Tradition, dass jedes Hochfest oder jeder liturgische Zeitabschnitt - Ostern, Weihnachten, Fastenzeit etc. - angekündigt und im voraus »vorbereitet« wird. Warum? Weil die Kirche ein tiefes psychologisches Gespür für die menschliche Natur hat. Da sie unsere mangelnde Konzentrationsfähigkeit und den erschreckenden Hang zur »Weltlichkeit« unseres Lebens kennt, weiß sie um unsere Unfähigkeit zu einem raschen Wandel, zu einem unvermittelten Hinüberwechseln von einem geistlichen oder geistigen Zustand in einen anderen. Deshalb lenkt die Kirche bereits lange vor dem Beginn des der Fastenzeit eigenen Bemühens unsere Aufmerksamkeit auf die ernsthafte Bedeutung dieser Zeit und lädt uns ein, deren Sinn betrachtend zu bedenken. Vor dem praktischen Vollzug der Fastenzeit wird uns deren Bedeutung gegeben.
Diese Vorbereitung umfasst fünf aufeinander folgende Sonntage,
die der Fastenzeit vorangehen, und von denen jeder - durch sein eigenes
Evangelium - einem grundsätzlichen Gesichtspunkt der Reue
gewidmet ist.
Der aller erste Hinweis auf die Fastenzeit erfolgt an dem Sonntag, an
dem das Evangelium über Zachäus (Lk 19,1-10) gelesen
wird. Es ist der Bericht über einen Menschen, der zu klein
ist, um Jesus sehen zu können, der aber so sehr von dem Wunsch
beseelt ist, ihn zu sehen, dass er auf einen Baum steigt. Wegen seines
brennenden Verlangens wendet Christus sich ihm zu und kehrt bei ihm
ein. So ist das Thema dieser ersten Ankündigung das brennende
Verlangen. Der Mensch folgt seinem brennenden
Verlangen. Man kann sogar sagen, dass der Mensch Verlangen ist, und
diese grundlegende psychologische Wahrheit über die
menschliche Natur wird durch das Evangelium bestätigt: »Da,
wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein« (Mt
6,21; Lk 12,34), sagt Christus. Ein heißes Verlangen
überwindet die natürlichen Grenzen des Menschen; wenn
er leidenschaftlich etwas wünscht, kann er Leistungen
vollbringen, zu denen er »normalerweise« nicht
fähig ist. Obwohl »klein« von Gestalt,
wächst er über sich hinaus und übertrifft
sich selbst. Die einzige Frage ist also, ob es die wahren
Güter sind, die wir begehren, und ob die Stärke
unseres Verlangens auf das wahre Ziel ausgerichtet ist oder ob, um die
Formulierung des atheistischen Existentialisten Jean-Paul Sartre zu
gebrauchen, der Mensch eine »unnütze
Leidenschaft« ist.
Das ist also die erste Ankündigung, die erste Einladung: wir müssen begehren, was das Tiefste und Wahrhaftigste in uns selbst ist, den Durst und den Hunger nach dem Absoluten in uns wiedererkennen, das, ob wir es nun kennen oder nicht, uns mit einer wahrlich »unnützen Leidenschaft« behaftet sein ließe, wenn wir uns von ihm abwenden und unsere Wünsche anderswohin lenken würden. Und wenn unser Verlangen hinreichend tief und stark ist, wird Christus darauf antworten.
aus: Schmemann,
Alexander, GREAT LENT. Journey to Pascha,
St. Vladimir´s Seminary Press, Crestwood, New York 1969
Die Große Fastenzeit, Askese und Liturgie in der
Orthodoxen Kirche, (aus dem Englischen übersetzt von Elmar
Kalthoff)
Veröffentlichungen des Instituts
für Orthodoxe Theologie der Universität
München, Bd. 2 1994, S. 15f.
Evangelium:
Mt 15: 21-28
Zur Vorbereitung auf die kommenden Fasten zeigt uns die Kirche nach dem Beispiel von Zachäus am vorigen Sonntag an diesem Sonntag den starken Glauben der Kanaanäerin.
Viele
Menschen kommen auf der Suche nach Linderung und Befreiung
von ihren Leiden zu Christus. Der Fall der kanaanäischen Frau
ist aber doch
besonders für uns als Vorbild geeignet. Eine Frau, die als
Heidin gilt, weil sie
nicht den Glauben des Volkes Israels bekennt, wie viele unter uns,die
auch
nicht in Allem dem Glauben der Kirche folgen- zeigt doch
unerschütterlichen
Glauben an den Gottessohn.
Das Evangelium empfiehlt uns eine
Glaubenserfahrung als Zugehörigkeit zur Person des
Gottessohns. Trotz der
offensichtlichen Hindernisse, die Christus ihr in den Weg stellt,
besteht sie
weiterhin darauf, daß Er ihr helfen wird.
Dies
ist der Weg, den das Evangelium jedem von uns aufzeigt. Der Glaube
dieser
Frau hat nichts mit Routine oder der Mittelmäßigkeit
unseres „Alltagsglaubens“ zu
tun.
Es ist ein lebendiger Glaube, der bettelt. Es ist ein energischer
Glaube, der
von Jesus Christus selbst geprüft wurde. Es ist ein Glaube an
Christus, der
wirklich bewegt. Es ist ein Glaube, der mit seinen kulturellen und
religiösen
Traditionen bricht.
Der Glaube der Kanaanäerin hat nichts mit einem schwachen,
legalistischen
Glauben zu tun.
Der Glaube bringt immer Früchte hervor. Aber die
Früchte entstehen, wenn es
eine wahre Umkehr gibt. Um nicht mehr auf uns selbst zu schauen,
sondern auf
Gott.
Dasselbe
gilt für uns in unserem Gebet, vor der Gegenwart Christi in
Seiner
Auferstehung müssen wir so viele Dinge
ändern, die uns von Ihm wegführen.
Dazu brauchen wir die Kraft uneingeschränkter Demut. Ungeahnte
Kraft zur Umkehr
in der Fastenzeit können auch wir durch diesen
demütigen Glauben bekommen.
Lassen wir uns weder von unseren Sünden noch von unserem Elend
entmutigen.
Schauen wir niemals zurück, das ist es, was der Fürst
der Lüge will.
Orientieren wir uns am Beispiel der Heiligen. Die Heiligen sind
Menschen, die
an die Liebe des Vaters geglaubt, sich vor Christus erniedrigt und ihre
Schwächen erkannt haben. Die Heiligen sind Menschen wie wir.
Bitten wir Christus, uns in den kommenden Wochen den GLAUBEN und die
DEMUT der
kanaanäischen Frau zu schenken.
VOR - FASTENZEIT
"Der UMKEHR Türen öffne mir ..."
~~~
Komponist: Artemij WEDEL /// Interpretation: F.TSCHALJAPIN mit Chor der
Russischen Orthodoxen Kathedrale Paris 1932 ~~~
zur Link-Quelle: "http://www.musicarussica.com"
~~~vollständig:Chor der
Christi-Verklärungskathedrale, Moskau /Regent Vladimir LVOV~~~
zur Link-Quelle: "http://en.liturgy.ru/zvuk/zvuk.php"
SONNTAGE der VOR-FASTENZEIT
1. Sonntag vom
ZÖLLNER
und PHARISÄER
1.2.
2026
2. Sonntag vom
VERLORENEN
SOHN
8.2.
2026
3. Sonntag FLEISCHENTSAGUNG
!
vom GERICHT
15.2.
2026
4. Sonntag BUTTERENTSAGUNG
!
vom VERLUST des PARADIESES VERGEBUNGSSONNTAG
22.2.
2026
- abends:
BEGINN der GROSSEN 40-taegigen FASTEN
Vor - Fastenzeit
Weil die Kirche mit ihrer 2000-jährigen Erfahrung ein tiefes psychologisches Mitgefühl mit der menschlichen Natur entwickelt hat. Sie kennt unseren Hang uns von den Oberflächlichkeiten unserer Umwelt einnehmen zu lassen und unsere mangelnde Konzentrationsfähigkeit auf die geistlichen Güter. Ein rascher Wandel unserer Alltäglichkeit, ein unvermitteltes Hinüberwechseln in eine noch nie auch nur erspürte Praxis birgt die Gefahr uns zu überfordern. Wir dürfen nicht Wunder fordern, sondern wir bereiten uns auf immer wieder neue Anstrengungen vor. Wir müssen uns darauf vorbereiten, nach jedem Fall niemals die Anstrengungen des Aufstehens zu scheuen, wieder an die Türen der Umkehr zu klopfen und uns wieder auf den Weg zu machen.
Dieser Mut und die Bereitschaft das Ringen auch durch Entbehrungen durchzuhalten ist besonders für die Zeit der Grossen 40-tägigen Fasten notwendig. Das aktive, bewusste Fasten ist ein deutliches Bekenntnis zur Möglichkeit der Überwindung der "animalischen Naturgesetze" und ein Zeichen der Bereitschaft zu wahrer Menschlichkeit im Ebenbilde Gottes.
Wenn wir dies Bedenken, dann wird uns das Fasten nicht als unliebsame Einengung erscheinen. Wir werden erkennen das Fasten nichts mit Trübsinn zu tun hat, sondern mit Freude die Gelegenheit zur Erneuerung des Lebens ergreifen.
Deshalb wollen wir das Fasten nicht nur als
äusserliche
Übung
der "Gesetzestreue" sehen, sondern als Gelegenheit uns dem Heil der
Vergöttlichung zu nähern:
Beginnend mit der Bitte, dass sich auch
für uns die
"TÜREN der UMKEHR" öffnen mögen !
Diese Zeit soll genutzt werden, um uns zu Besinnen, uns zu überlegen und wenn möglich mit dem Beichtvater abzusprechen in welcher Weise wir am Fasten der Kirche in unseren konkreten Lebensumständen teilhaben können. Realistischerweise wird uns nämlich ausser in Klöstern die genaue Einhaltung aller Fastenregeln der Kanones (kat´akrib ei an) nicht so ohneweiteres möglich sein. Gleichzeitig wird ein am Sinn und nicht nur am Buchstaben orientiertes Fasten auch weitgehenden Verzicht auf die Genussmittel, Süssigkeiten, Fernsehen und andere "Suchtmittel" unserer Zeit bedeuten. Dies vor allem, um frei zu werden, die "Lebensqualität" eines inneren geistlichen Lebens für uns neu zu entdecken und zu intensivieren.
Die Vorfastenzeit bietet Gelegenheit zur konkreten Planung dieser Umkehr. Aus praktischer Erfahrung ist es auch empfehlenswert die Umsetzung der Pläne "austesten", um für die 40 Tage nur Vorsätze zu fassen, die wir dann auch weitgehend umsetzen können.
Wichtig ist es aber auch, sich auch gleich darauf vorzubereiten, dass wir nach jedem Fall auch wieder bereit sind aufzustehen - und das "Rennen" fortzusetzen. Nicht umsonst werden wir auch an die 40 Jahre erinnert, in denen das Volk des Herrn auf dem Weg durch die Wüste die neu gewonnene Freiheit erprobte:
- aber auch immer wieder durch Gottes Gnade und menschliche Anstrengung wieder versöhnt mit dem Schöpfer des Lebens.
ER will uns nie vernichtend strafen, sondern wie es uns Christus während Seiner 40 Tage in der Wüste gezeigt hat, immer wieder für uns und unsere Erlösung mit dem Satan, dem Versucher, ringen. Wir können darüber umso mehr Freude empfinden, je öfter wir nach unseren Sündenfällen wieder aufstehen und den Kampf wieder aufnehmen.
"Nur vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und nur ihm allein dienen" (Lk 4,8) erinnert uns der Apostel an dieses Privileg der "Synergie", der Einladung Gottes an uns, unsere begrenzten Kräfte mit Seiner Allmacht zu verbinden.
Bereiten wir uns auf die freudebringenden
Anstrengungen dieses Kampfes
vor, um dann nach der "Vollendung der 40 Tage" auch mit wenigstens
teilweise verdienter Freude die Früchte der Auferstehung
ernten zu
dürfen !
~~~ Komponist: Artemij WEDEL /// Interpretation durch grossen Chor ~~~
www.musicarussica.com - RealAudio
Der Umkehr Pforten öffne mir,
Du, Der Du das Leben schenkst !
...
Denn durch schändliche Sünden habe ich meine Seele befleckt
und mein Leben in Nachlässigkeit vergeudet.
...
In Deiner Güte mache mich rein
durch Deine huldvolle Milde !
~~~vollständig:Chor der Christi-Verklärungskathedrale, Moskau /Regent Vladimir LVOV~~~
aus: "http://en.liturgy.ru/zvuk/zvuk.php"
Sonntag
vom Zöllner und Pharisäer
Apostel:
2 Tim 3:
10-15
Evangelium: Lk 18: 10-14
Das Evangelium macht aber sofort deutlich, dass damit nicht ein gesetzlicher Konservatismus gerechtfertigt werden soll:
Der Pharisäer, der getreu alle überkommenen Vorschriften einhält, und sich dessen vor Gott rühmt, wird beschämt durch den ausserhalb des Gesetzes stehenden Zöllner, der in Demut seine Unwürdigkeit bekennt.
Am ersten Vorfastensonntag werden wir auf die erste Voraussetzung dafür hingewiesen, dass die kommende Fastenzeit für uns heilsam wird:
DEMUT
Lasset
uns fliehen
die hochmütige Prahlerei des Pharisäers
und lernen
das demütige Seufzen des Zöllners !
Zu unserem Erlöser lasset uns rufen:
Vergib uns,
Allerbarmer !
- als solche, die kommen zur wahren Verwirklichung dessen, wozu wir berufen sind
- oder als solche, die in den "Naturgesetzen" ihrer Umgebung verfangen sind - und so das eigentliche Ziel ihres Lebens verfehlen.
"Er betet bei sich selbst: ich danke Dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen"
Er "steht von Ferne und wagt es nicht, seine Augen gen Himmel zu erheben". Er weiss um die Distanz zur erhabenen, ganz anderen Wirklichkeit des über alles erhabenen, allerhöchsten Gottes über jeden Gott, DEN, zu dem sich der selbstgerechte Mensch selber machen wollte. Er weiss um seine Schulden, die Sünden und "klopft an s e i n e Brust", nicht an die Brust der anderen um andere für deren Vergehen zu tadeln. Er weiss, das sein Schöpfer auch sein ihn liebender Erlöser ist, der ihm sogar an seiner göttlichen Natur Anteil geben will. Der sich selbst richtig einschätzende Zöllner (= der Sünder par excellence), e r b i t t e t das Erbarmen Dessen, Der die Liebe ist:
"Gott, gewähre mir Deine Gnade !"
“Gott,
sei mir Sünder gnädig!“
Predigt zum Sonntag des Zöllners und
Pharisäers von P. Konstantinos, München
* Quellenhinweis *
Die heutige
Evangeliumsperikope zeigt uns zwei Arten von
Gläubigen; zwei charakteristische Typen von Menschen, die in
die
Kirche kommen. Der erste kommt, um sich zu zeigen, um anzugeben, um
sein angeblich so heiliges Leben vorzustellen, um die Bewunderung der
anderen zu erregen, um Gott, seiner Ansicht nach, zu verpflichten
für seine Taten, für seine Tugenden, die der
Bewunderung und
des Lohnes würdig sind.
Ich möchte nicht länger bei der Charakterisierung und Beschreibung dieser Art von Menschen verbleiben. Ich möchte, dass wir uns etwas mehr Gedanken machen über eine andere Art, nämlich über jenen, den der Pharisäer verachtet, auf den er mit dem Finger zeigt und über den er schlecht redet.
Es waren dies seine einzigen Worte, aber sie kamen tief aus seinem Herzen. Worte der Reue und Buße, die zeigten, dass in dieser Brust seine Seele litt und eine geistige Geburt, eine seelische Wiedergeburt möglich wird. In diesem Kampf in seiner Brust stürzte der Zöllner den Sünder in sich vom Sockel seiner Geldgier und legte den Grundstein für ein neues Leben. Das ist das Werk der Buße. Als der Zöllner zu bereuen begann, erfuhr er die erste Frucht dieser Tugend: die Demut.
Man sagt, dass die Demut die Tugend der Alten und der Weisen sei. Aber auch der Zöllner zeigte sich demütig. Ganz hinten im Tempel klopfte er sich an die Brust und sagte: „Gott, sei mir Sünder gnädig!“ Seht seine große Demut, ganz spontan kamen ihm diese Worte über seine Lippen. Und diese Worte waren nicht von der satten Arroganz der dürren Worte des Pharisäers.
Die aufrichtige Reue des Zöllners führte ihn zur Demut, welche „die beste der Tugenden ist“, wie uns der hl. Augustinus sagt, und diese führt uns weiter zum Gebet, das eine „Kraftreserve“ ist, wie es ein anderer Denker ausdrückte. Die Tradition überliefert uns, dass König David, als er seine übergroße Sünde bereute, bitterlich weinte, wie es der 50. Psalm beschreibt, den wir in vielen Andachten unserer Kirche lesen. Aus den Tränen Davids wuchsen aus der Erde zwei Bäume: eine Weide, die auf immer trauert und eine Zeder, deren Harz sich in Weihrauch verwandelt.
Tatsächlich Quellen aus der aufrichtigen Reue zwei Tugenden: die Demut, die der Weide gleicht, die ihre Zweige nach unten neigt und das Gebet, das wie Weihrauch zum himmlischen Altar Gottes aufsteigt.
Das ist die Dreiheit der Tugenden - Reue und Buße, Demut, Gebet -, die uns heute das Triodion der Zerknirschung in Erinnerung bringt. Das Triodion, das heute beginnt, ist die Zeit, die uns auffordert, uns auf diese Tugenden zu besinnen. Jeder Sonntag des Triodions erinnert uns an eine andere Tugend. Die Kette unserer Tugenden verbindet uns mit dem gütigen Gott.
Selig
werden sein,
die in der heutigen Zeit der Gleichgültigkeit im Glauben, ja
seiner Ablehnung,
es zustande bringen,
sich durch dieses Band mit Jenem zu verbinden,
der den Zerknirschten und Demütigen im Geiste nahe ist.
Amin.
Übersetzung aus dem Griechischen: G. Wolf
Sonntag
vom Verlorenen Sohn
https://youtu.be/Ur39cbcr_pk
Apostel:
1 Kor 6: 12-20
Evangelium: Lk 15: 11-32
Vater Alexander
Schmeman:
"
Rückkehr aus dem Exil "
Die
Apostellesung dieses Herrentages stellt die christliche Freiheit heraus
und steckt damit die Grenzen des Fastengebots ab:
"Alles ist mit erlaubt, aber
ich soll mich von nichts
beherrschen lassen"
Damit ist das Fasten jeder fremden
Beurteilung von aussen entnommen. Es
kann daher nach orthodoxem Verständnis auch nicht zum
öffentlichen Gesetz werden, zumal es, wie der Herr anweist (Mt
6: 16-18) im Verborgenen geschehen soll.
Das Evangelium stellt dann den eigentlichen Sinn der Fastenzeit heraus:
Der Aufbruch zur Umkehr zum Vater, der den Verlorenen Sohn mit Freuden
aufnimmt und reich beschenkt. Es ist wohl kein Zufall, dass an diesem
Herrentag erstmals im Nächtlichen Psalmengebet (Ps 136)
angestimmt wird.
Deine
väterliche Herrlichkeit
habe ich ohne Verstand verlassen.
übel verschwendet habe ich den Reichtum
den Du mir gegeben hast.
So rufe ich Dir die Worte des Verlorenen Sohnes zu:
"Ich habe gesündigt gegen Dich,
barmherziger Vater.
Nimm mich auf,
der ich umkehre,
und lass mich bei Dir sein
wie einen Deiner Taglöhner !"
Alles, was er hat, das hat er von Gott.
Er zieht in ein gottfernes Land, liefert sich einer gottfernen Gesellschaft aus.
Er nimmt so viel er kann aus seiner Mitgift, dem Eigentum Gottes.
Er verschwendet es hemmungslos an Idole, die ihm kurzfristig faszinierend erscheinen.
Als es seine Mitgift verbraucht hatte, im Genuss des Materiellen, Innerweltlichen, tritt die Hungersnot ein. Nichts vermag ihn zu sättigen im Anblick des Absterbens seiner Lebendigkeit, niemand, keine Parole kann ihn mehr begeistern.
Keines seiner Idole kommt ihm zu Hilfe: "Ich sterbe hungers !"
Aber er hat noch die Kraft seine Niederlage einzugestehen:
"Wie viele Tagelöhner im Hause meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen".
Es ihm gleich zu tun, dazu fordert uns die Kirche auf, jetzt in der Zeit des Aufbruchs in die Grossen Fasten vor der Auferstehung.
"Ich
will mich aufmachen", ich will aufstehen, damit Überblick
gewinnen, Gewohntes verlassen
und mich auf den Weg machen,
den die Fastenzeit mir öffnet, hin zum Vaterhaus.
Das ist das Ziel: zu Gott, zu unserem Vater zu gelangen.
Er macht mich frei.
Er nährt mein innerstes Leben.
Er will mir in der Wohnung Seiner Herrlichkeit Geborgenheit auf ewig
bieten.
Wer könnte sagen, er wäre ohne Sünde: "Weil kein Mensch lebt ohne zu sündigen" (1 Könige 8: 46) ?
Es tut uns gut, wenn wir noch sagen können: "Ich habe mich versündigt an der Liebe zu Gott und den Nächsten" !
Gott umarmt uns als Seine Kinder.
Gott schützt uns mit Seiner Kleidung (in der Taufe haben wir "Christus angezogen"), der besten Kleidung, der Kleidung der Kindschaft Gottes -wenn wir uns blossgestellt fühlen, wie einst Adam.
Gott setzt uns ein, in Sein Erbe, das unverwesliche Erbe der Unsterblichkeit.
Und trotz all dieser Gaben will er unsere Freiheit: Er gibt uns den Siegelring der Freien.
Die Kirchenväter deuten es noch tiefer:
Die Schuhe weisen auf die Befähigung auf dem Weg (Christi) fortzuschreiten, das Siegel auf das Siegel des Heiligen Geistes.
Unser Vater bereitet uns das Freudenmahl -das Ostermahl, -die Göttliche Liturgie.
Auch wenn wir dem zweiten Sohne gleichen, der tief in seinen Alltag verstrickt ist, und glaubt durch äusserliche "Anständigkeit" immer im Sinne des Vaters gehandelt zu haben, und so zum Knecht seiner Selbstgerechtigkeit geworden ist, und wenn wir, wie er, nicht hineingehen wollen, um uns für das Freudenfest bereit zu machen, so sucht uns doch der Vater heim:
"Da kam sein Vater heraus, und redete ihm zu"
Hören auch wir auf Gott, unseren Vater wenn er uns durch die Tradition der Kirche jetzt in der Vorfastenzeit auf das österliche Freudenfest vorbereitet !
Ja, ich werde die Fesseln der Torheit lösen, die mir von Ihm geschenkten Reichtuemer nicht mehr mehr mit Sündern verschwenden, sondern mich aufmachen und zu meinem mitfühlenden Vater zurückkehren.
An
den Flüssen von Babylon saßen wir ...
gedenkend der Stadt des Herrn ...
Wie könnten wir dem Herr ein Lied singen
in einem fremden Land ?
Sollte ich dich vergessen, o Stadt meines Gottes,
so verdorrt meine rechte Hand
so klebt meine Zunge am Gaumen
wenn ich Deiner vergesse,
wenn ich nicht Gottes Stadt über alle meine Freuden stelle ...
"An
den Flüssen von
Babylon ..."
~~~ Na Rekach
Babylonskich ~~~
Chor des Klosters in Pyuchtiza
Erzpriester
Alexander Schmemann:
(langjähriger Dekan der Orthodoxen Theologischen Akademie der
USA St. VLADIMIR´s)
aus: Schmemann,
Alexander, GREAT LENT. Journey to Pascha,
St. Vladimir´s Seminary Press, Crestwood, New York 1969
Die Große Fastenzeit, Askese und Liturgie in der
Orthodoxen Kirche, (aus dem Englischen übersetzt von Elmar
Kalthoff)
Veröffentlichungen des Instituts
für Orthodoxe Theologie der Universität
München, Bd. 2 1994, S. 15f.
Rückkehr
aus dem Exil
zum
Sonntag vom Verlorenen
Sohn
Zusammen mit den Hymnen dieses Tages erschließt uns dieses Gleichnis die Zeit der Reue als die Rückkehr des Menschen aus dem Exil.
Ein fernes Land...Das ist die einzig zutreffende Bezeichnung für unsere Bedingtheit als Mensch, die wir annehmen und zu der unseren machen müssen, wenn wir unseren Weg zu Gott hin beginnen.
Ein Mensch, der niemals diese Erfahrung gemacht hat, und sei es auch
nur für kurze Zeit, dass er in der Gottesfeme lebt und von dem
wahren Leben abgeschnitten ist, wird niemals verstehen, was es mit dem
Christentum auf sich hat.
Und jemand, der vollständig in dieser Welt und in dem Leben
dieser
Welt »zuhause« ist, der nie von dem
sehnsuchtsvollen Wunsch
nach einer anderen Wirklichkeit schmerzlich getroffen wurde, der wird
nie verstehen, was bereuende Umkehr ist.
Man übersieht jedoch etwas sehr Wesentliches, ohne das weder das Schuldbekenntnis noch die Absolution eine wirkliche Bedeutung oder Wirksamkeit erlangen können. Dieses »Etwas« ist ganz genau das Empfinden des Verbanntseins von Gott, weit verbannt von der Freude der Gemeinschaft mit ihm und fern dem wahren Leben zu sein, das durch Gott geschaffen und geschenkt wird. Es ist in der Tat leicht zu bekennen, dass ich an den vorgeschriebenen Tagen nicht gefastet habe, dass ich meine Gebete vergessen habe oder jähzornig gewesen bin. Eine ganz andere Sache ist es jedoch, wenn ich mir unvermittelt eingestehen muss, dass ich Schande auf mich geladen und meine geistliche Schönheit verloren habe, dass ich mich sehr weit von meinem eigentlichen Zuhause, von meinem wahren Leben entfernt habe, und dass ich in dem innersten Gewebe meiner Existenz etwas Kostbares, Schönes und Reines in nicht wiedergutzumachender Weise zerstört habe. Indessen bedeutet dies, und nur dies, die bereuende Umkehr, und deshalb entsteht auch ein tiefgreifendes Verlangen, umzukehren, zurückzugehen und jenes verlorene »Heim« wiederzufinden.
Von Gott habe ich wunderbare Reichtümer erhalten:
zunächst das Leben und die Möglichkeit, mich dessen
zu erfreuen,
ihm einen Sinn geben zu können,
es mit Liebe und Erkenntnis ausfüllen zu können;
dann – in der Taufe –
das neue Leben in Christus selbst,
die Gabe des Heiligen Geistes,
den Frieden und die Freude auf das ewige Königreich.
Ich habe die Erkenntnis Gottes erhalten,
und in ihm die Erkenntnismöglichkeit einer jeden Sache,
und die Kraft, Kind Gottes zu sein.
Aber die Kirche ist da, um mich daran zu erinnern, was ich aufgegeben und verloren habe.
Und während sie mir dies ins Gedächtnis zurückruft, erinnere ich mich; so wie es das Kontakion dieses Tages ausdrückt:
»Fern von der Herrlichkeit des Vaters bin ich in meiner Torheit Fesseln umhergeirrt
und habe mit den Sündern die Reichtümer, die du mir anvertraut hattest, verschwendet.
So rufe ich mit dem verlorenen Sohn zu dir:
Barmherziger Vater, ich habe gegen dich gesündigt.
Nimm mich reuigen Sünder wieder auf und nimm mich an wie einen deiner Tagelöhner ... !« Und während ich mich erinnere, spüre ich in mir das Verlangen und die Kraft zurückzukehren:
»... Ich werde mich aufmachen und zu meinem mitfühlenden Vater zurückkehren
und werde zu ihm unter Tränen sagen:
Nimm mich auf wie einen deiner Diener! «
In diesem Sinne singen wir heute den sehnsuchtsvollen Psalm 136:
An
den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten,
Sions gedenkend...
Wie könnten wir dem Herrn ein Lied singen, in einem fremden
Land?
Sollte ich dich, o Jerusalem, vergessen, soll meine Rechte verdorren!
Meine Zunge klebe an meinem Gaumen, wenn ich deiner vergesse,
wenn ich nicht Jerusalem über alle meine Freuden stelle ...
Erzpriester
Alexander Schmemann:
(langjähriger Dekan der Orthodoxen Theologischen Akademie der
USA St. VLADIMIR´s)
aus: Schmemann,
Alexander, GREAT LENT. Journey to Pascha,
St. Vladimir´s Seminary Press, Crestwood, New York 1969
Die Große Fastenzeit, Askese und Liturgie in der
Orthodoxen Kirche, (aus dem Englischen übersetzt von Elmar
Kalthoff)
Veröffentlichungen des Instituts
für Orthodoxe Theologie der Universität
München, Bd. 2 1994, S. 15f.
"An den Flüssen von
Babylon ..."
~~~ Na Rekach Babylonskich ~~~
Chor des Klosters in Pyuchtiza
Sonntag der
beginnenden FLEISCHENTHALTUNG
Sonntag vom Gericht
Apostel:
1 Kor 8:8 - 9:2
Evangelium: Mt 25: 31 - 46
Dieser
Herrentag wird nach dem Evangelium "vom Gericht" oder nach der
Tradition der Kirche "Herrentag der Fleischenthaltung"
(= APOKREO = MESOPUSTNA = Carne val) genannt. Mit dem Abendgottesdienst
an diesem Sonntag beginnen die Gläubigen sich in
Fleischenthaltung zu üben.
In der folgenden Woche wird der Körper noch einmal mit Milch,
Butter und Käse gelabt, bevor danach am Abend des
nächsten Sonntags die Grossen 40-tägigen Fasten vor
der österlichen Festzeit beginnen.
Unser Fasten nimmt dieses Friedensreich im Glauben vorweg.
Die Apostellesung betont wieder einmal die wahrhaft christliche Freiheit gegenüber allen religiösen Speisevorschriften:
Brüder,
Speise wird uns nicht vor Gott bestehen machen;
weder fehlt uns etwas, wenn wir nicht essen,
noch gewinnen wir etwas, wenn wir essen"
(1 Kor 8:8 )
Erwählten wie Verworfenen,wird nach ihrem Tun Heil oder Unheil zuteil:
Aber sie erkennen erst jetzt, dass nicht die Befolgung irgendwelcher hochgesteckten abstrakten Prinzipien sondern die Art ihres Verhaltens gegenüber dem Schwächeren Mitmenschen entscheidet !
Vor dem ewigen Gericht werden jene in das Reich Gottes eingehen, die ihre Liebe konkret an ihren Mitmenschen bewiesen haben:
Sünde ist Trennung und Isolierung von Gott, da Gott der Absolut Liebende ist. Und so wie Gottes Liebe zu uns konkreten unwürdigen menschlichen Individuen sind wir zu konkreter Liebe zu jeder menschlichen Person aufgerufen, der uns Gott in unserem Leben begegnen läßt.
Die christliche Liebe ermöglicht uns in jedem Menschen, der uns begegnet Christus zu sehen. Jeden Menschen, den Gott in Seinem unerforschlichen und ewigen Plan in mein Leben geführt hat, und sei es auch nur für einige Augenblicke, hat Er zu mir geführt um mir Gelegenheit zu geben an Seiner Liebe zu allen Geschöpfen teilzuhaben. Denn ist Seine Liebe nicht jene alle Äußerlichkeiten, alle Andersartigkeit, alle Herkunft und Intellektualität übersteigende Kraft die zur jeweils einzigartigen personalen Wurzel seines menschlichen Seins vorstößt, das wir getrost makellos und absolut sehen dürfen: seine ihm vom Schöpfer eingehauchte Seele, die wahrhaft göttliche Seite jedes Mitmenschen. Die christliche Liebe ist tätige Bekräftigung dieses Glaubens. Und diese Liebe ist so wie Gottes Liebe immer konkret. Wir sind damit nicht aufgerufen, allgemein und abstrakt die "Menschheit" allgemein und nicht in Form irgendwelcher Pläne für die Zukunft, die konkret gegen einzelne Personen und in einer konkreten "Etappe" "über Leichen geht", zu lieben, sondern immer die konkrete Person, die HIER und JETZT vor uns steht !
Wir wissen, dass alle Menschen dieser personalen Liebe bedürfen - dem Erkennen ihrer einzigartigen Seele in ihnen, in der sich die Schönheit der ganzen Schöpfung in einzigartiger Weise widerspiegelt.
Und so haben auch wir diese Liebe nötig:
Jetzt - und am Tage unseres Gerichtes !
Wir können das ewige Heil nicht erlangen, ohne die verzeihende Liebe dessen, der uns durch den Hauch Seiner Liebe das Leben gegeben hat und Der uns dann daran messen wird,
ob wir diese Liebe erhalten und weitergegeben haben.
Wenn Du, o Gott, kommen wirst
auf Erden in Herrlichkeit
wird das All erzittern
und von Deinem Richterstuhl ein Feuerstrom ausgehen,
die Bücher werden geöffnet und das Verborgene wird
offenbar.
Dann errette mich aus dem nie erlöschenden Feuer
und würdige mich,
zu Deiner Rechten zu stehen,
gerechtester Richter !
Kommet, lasset uns dem Herrn frohlocken,
jauchzen dem Fels unseres Heils !
Lasset uns vor Sein Angesicht treten
mit unserem Bekenntnis !
Mit Psalmen lasset uns Ihm zujubeln !
"Die
Tueren zur Umkehr, oeffne mir, Lebensspender ! ..."
~~~
Komponist: Artemij WEDEL /// Interpretation: F.TSCHALJAPIN mit Chor der
Russischen Orthodoxen Kathedrale Paris 1932 ~~~
Der
Umkehr
Pforten öffne mir,
Du, Der Du das Leben schenkst !
frühmorgens strebt zu Deinem
heiligen Tempel
mein Geist,
er trägt den ganz befleckten Tempel meines Leibes¸
doch als der Gütige
reinige ihn
durch Dein wohlwollendes Erbarmen.
...
denn durch schändliche Sünden habe ich meine Seele befleckt
und mein ganzes
Leben im Leichtsinn vergeudet;
doch du
rette mich durch deine Fürbitten von jeder Unreinheit.
...
Die Menge der von mir begangenen Missetaten bedenkend,erschaudere
ich Armseliger vor dem
furchtbaren Gerichtstag;
aber hoffend auf Deine Güte,
rufe ich wie David zu Dir:
Erbarme Dich meiner, o Gott, nach Deinem großen
Erbarmen.
Sünde, UMKEHR, Reue
und
Vergebung in der Hl.Schrift
und die Bedeutung für uns.
Aus dem 2.Vortrag von Vater
FJODOR
Hölldobler, Herbstseminar 1998
Bischofsheim a.d.Rhön
Hier wird der "büssende David" genannt, "der sich von seinen Verfehlungen bekehrt hat".
David
war ohne Zweifel der modernste Staatsmann im Vorderen Orient
seiner Zeit. Er war kein orientalischer Despot,
sondern hing persönlich an der Überlieferung seines
Volkes,
die aus der Wüstenzeit herkam. Er war Landsknecht,
Künstler,
Gottsucher, Prophet und Fürst zugleich. In David verstand sich
Israel aufs neue von Gott erwählt und geführt. Aber
in David
hatte alles Menschliche Raum, im Guten wie im Bösen, wie diese
Geschichte zeigt. Die Busse, zu der David fähig war, zeigt
seine
Grösse als religiöser Mensch, als Prophet und
Künder des
Bussgedankens.
Gemeint ist die Frau, die ins Haus kam, als er Gast im Hause des Pharisäers Simon war, Lk 7: 37. Die Erzählung vom Mahl beim Pharisäer Simon wird von Lukas allein überliefert, ist jedoch mit jener von Mt 26: 7 -13 verwandt, wo eine Frau im Hause Simons des Aussätzigen in Betanien Jesu Füsse salbt. Dort ärgert sich manch einer unter den Jüngern Jesu wegen der "Verschwendung", hier hingegen der Pharisäer, weil die Frau eine Dirne ist, die mit Jesus in Kontakt kommt. Diese Begebenheit ist Anlass für eine bemerkenswerte Lehre des Evangeliums (7:47): Wer für viele Sünden Verzeihung erlangt hat, wird viel Liebe zeigen.
Wenn wir nun die genannten Schriftstellen vergleichen, so sehen wir, dass die genannten Sünden eine gemeinsame Wurzel haben.
Das ist einfach die GOTTVERGESSENHEIT.
Manasse erliegt den Einflüsterungen seiner Ratgeber, die ihm versprechen, dass er so reich und mächtig würde wie die Assyrer, wenn er Götterbilder aufstellen lässt so wie sie, und vergisst seinen Gott. Wer seinen Leib der Hurerei hingibt, der vergisst, dass dieser ein Tempel Gottes ist ( 1 Kor 3: 16 ). "Hütet euch vor der Unzucht ! Jede andere Sünde, die der Mensch tut, bleibt ausserhalb des Leibes.
Wer aber Unzucht treibt, versündigt sich gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt ?" ( 1 Kor 6: 17 )
Als Petrus sagt: "Ich kenne diesen Menschen nicht !" hat er Ihn in diesem Augenblick tatsächlich nicht mehr gekannt. Er hat alles vergessen aus der existentiellen Bedrohung heraus.
Deshalb verwendet die Orthodoxie soviel
Kraft auf die
Heiligung der
Sinne, auf die Vergöttlichung der sinnlichen Sphäre,
um dem
Menschen die Verführbarkeit durch die entsprechenden Anreize
zu
nehmen.
Adam und Eva "vergessen" Gottes Gebot / Kain vergisst seinen brüderlichen Auftrag / Noahs Zeitgenossen vergessen ihren Schöpfer / die Turmbauer zu Babylon vergessen Gottes Allmacht / Jakobs Brüder vergessen, dass Gott erwählt / die Israeliten vergessen Seine Führung und beten das goldene Kalb an / zwei Söhne des Aaron vergessen ihren priesterlichen Dienst und meinen "Feuer ist Feuer" / das Volk vergisst seinen Ernährer und wünscht sich zurück an die ägyptischen Fleischtöpfe / Aaron und Miriam vergessen, dass sie sich nicht mit Moses vergleichen können und dass Er -ihm- das Volk anvertraut hat / Korah und andere Gemeindevorsteher vergessen, dass Moses der von Gott erwählte Führer ist und bestreiten seine Autorität, mit dem Argument, die ganze Gemeinde sei heilig. / Vor der Schlangenplage vergessen die Leute Gottes Wohltaten und lästern gegen das Manna / im Gelobten Land vergessen sie wieder Gott und beten fremde Götter an, die Kanaaniter können sie besiegen.
Die Gottvergessenheit durchzieht die ganze Geschichte des Gottesvolkes.
Kaum ging es allen gut und sie lebten in Frieden vergassen sie Gott und kehrten erst durch die Umstände belehrt zurück.
Die Rückkehr ins Vaterhaus geschieht durch das Busssakrament.
Joh 20: 19 - 23 berichtet seine Einsetzung.
Das Gebet des Priesters bei, bzw. vor
der Beichte zitiert Mt 18: 22,
wo
der Herr auf die Frage des Petrus hin sagt, dass die Sünden
siebenundsiebzigmal vergeben werden sollen.
Der Neue Bund hat uns
Gottes verzeihende Liebe nahegebracht und der Priester, der die Macht
hat, zu binden und zu lösen,
wird sich in verantwortungsvoller
Weise darauf einstellen .
"Die
Tueren zur Umkehr, oeffne mir, Lebensspender ! ..."
~~~
Komponist: Artemij WEDEL /// Interpretation: F.TSCHALJAPIN mit Chor der
Russischen Orthodoxen Kathedrale Paris 1932 ~~~
zur Link-Quelle: "http://www.musicarussica.com"
Sonntag vom VERLUST
des PARADIESES
VERGEBUNGSSONNTAG !
BUTTERENTSAGUNG !
- am Abend des
Sonntags:
BEGINN der GROSSEN 40-taegigen FASTEN
"Über die
Vergebung"
von Erzbischof Antonij von Surozh (London)
Apostel:
Rm 13:11 - 14:4
Evangelium: Mt 6: 14 - 21
Das
Evangelium dieses Sonntags, an dessen Abend die Grossen Fasten
beginnen, erinnert uns daran, dass wir Vergebung vom Herrn erst
erwarten können, wenn wir nicht selbst bereit sind, unseren
Mitmenschen zu vergeben, was sie uns an Verletzung zugefügt
haben - und sie unsererseits um Vergebung zu bitten für das,
was wir bewusst oder unbewusst an ihnen gefehlt haben.
Darum findet an diesem Sonntagabend nach der Vesper in die Handlung des
Gegenseitigen Vergebens statt, wie sie am Schluss des Apodipnons in
Klöstern täglich geübt wird. In manchen
Kirchen wird
dieser Ritus aus praktischen Gründen unmittelbar nach der
Liturgie
ausgeführt. In den Häusern ist die Vergebung als
Abschluss
der Karnevals- und Butterwoche mit einem Fest vor allem für
die
Kinder verbunden, dabei werden zum letzten Mal die Milch- und
Butterspeisen genossen.
Die folgende Woche ist ganz dem intensiven
Fasten gewidmet. Es beginnt die fortlaufende Lesung aus dem
Buch Genesis, die im Sündenfall und dessen Folgen
mündet. Mit dem Verlust des uns von Gott bereiteten Paradieses
durch unsere selbstzerstörerischen Abwege beginnt auch die
Sehnsucht nach dem Ende der widernatürlichen Sünden
und dem neuen Paradies. Die dafür erforderliche Bereitschaft
zur Umkehr wird in der kommenden Woche durch das Gebet des heilsamen Busskanons des
Hl.Andreas von Kreta
gefördert. Wir fühlen mit, dass wir mit unseren
Sünden nicht allein sind, aber werden auch dazu ermutigt, uns
den Figuren des Bibel anzuschliessen, die den Mut fanden, Gott um
Vergebung zu bitten, und Ihm damit wieder nahe zu kommen.
Trotz -und vielleicht wegen- all unserer negativen Erfahrungen ruft uns
die Apostellesung zu:
"
Jetzt ist unser Heil näher als damals, da wir gläubig
wurden.
Die Nacht ist vorgerückt, der Tag hat sich genaht "
(Rm 13:11 ff)
Für die Fastenzeit wird uns mitgegeben:
"
Wer isst, soll den nicht verachten, der nicht isst;
und wer nicht isst, soll den nicht richten, der isst;
denn Gott hat ihn angenommen.
Wer bist du denn, dass du einen fremden Knecht richtest ?
Seinem eigenen Herrn steht oder fällt er - aber er wird
stehen; denn der Herr hat die Macht, ihn aufrecht zu erhalten "
(Rm 14: 3-4)
Führer auf dem Weg
der Weisheit,
Urgrund des Verstandes,
Lenker der Unverständigen
und Beschützer der Armen,
festige, unterweise mein Herz, Gebieter.
Gib mir das Wort, Du Wort des Vaters !
Denn, siehe, nicht lassen ab
meine Lippen zu Dir zu schreien:
Barmherziger,
erbarme Dich meiner,
des Gefallenen !
(Kondakion)
Über die
Vergebung
zum Sonntag der Vergebung
von Erzbischof Antonij von Surozh (London)
Wenn mir jemand ein Unrecht zugefügt hat, das ich vergebe und vergesse, dann sind wir beide in Gefahr, dass das gleiche sich wiederholt, denn einerseits entsteht und vergeht diese Verzeihung auf der Stelle: sie ist nichts Beständiges und auf die Zukunft hin Ausgerichtetes.
Etwas Vergangenes ist an eine Grenze gelangt, die es nicht überschreitet;
die Zukunft ist ohne Erfahrung aus der Vergangenheit.
Andererseits, wenn ich vergesse, vergesse ich zweierlei: wohl vergesse ich das Unrecht, das mir angetan wurde, gleichzeitig aber auch den Grund, aus dem es mir zugefügt wurde, und ich kann den Betreffenden niemals vor der Versuchung bewahren, in die gleiche Situation zurückzuverfallen.
Man
muss sich erinnern, dass dieser Mitmensch, sobald er in jene
bestimmte Lage versetzt wird, diese bestimmte Schwierigkeit hat;
folglich darf man ihn nicht wieder in dieselbe Lage bringen;
man muss die zurückbleibende Schwäche erkennen.
Darum ist es so wichtig, sich zu erinnern, denn das ist die einzige
Möglichkeit das Verzeihen fortzusetzen.
„Ich habe dir deine ungeduldige Handlung verziehen, aber ich
habe
dadurch entdeckt, dass diese bestimmte äußerung,
jene Geste,
diese besondere Situation sie hervorrufen können.“
Es gilt, den andern vor diesen Situationen zu bewahren, solange, bis
man ihm geholfen hat die notwendige Kraft zu gewinnen, die Spannung zu
überwinden. Andernfalls stoßen wir unsere
Mitmenschen
ständig neu in Situationen hinein, wo sie unfehlbar auf die
gleiche Weise reagieren werden, wie sie das Problem hervorrief.
Außerdem
ist das Verzeihen eine besondere Weise, einen anderen
Menschen anzunehmen.
Das beginnt in dem Augenblick in dem man sagt: „Ich nehme
dich
an, so wie du bist. So wie du bist trage ich dich, wie man ein Kind
über eine schwierige Stelle hinwegträgt oder wie man
ein
Kreuz trägt, aber ich weise dich nicht zurück. Zu
sagen, dass ich dich annehme, so wie du bist, heißt
keineswegs, dass du bist wie du sein solltest.“
Nur
wenn man einen Menschen so annimmt, wie er ist, kann man ihm helfen
sich zu ändern.
Aber man darf nicht zuerst fordern, er müsse sich
ändern, um ihm zu versprechen, hernach werde man ihn lieben.
Im Russischen sagt man: „Liebe mich schwarz ! Wenn ich erst
weiß bin, werden alle mich lieben.“
Es gibt nur Probleme wo der Mensch sie schafft. Ein Mensch aber, der
Probleme schafft, muss so sehr geliebt werden, dass er im Vertrauen den
Glauben an sich selber wiederfinden kann, die Selbstachtung und jene
schöpferische Hoffnung, die ihm ermöglichen wird,
sich zu ändern.
Folglich
übernimmt man mit dem Verzeihen die Verantwortung für
einen Menschen, so wie er ist, mit der Hoffnung auf die Zukunft, jedoch
ohne Bedingungen zu stellen!
Man verzeiht nicht unter Bedingungen. Es geht nicht an, einem Menschen
„mit Bewährungsfrist“ zu verzeihen. Das
zeigt sich sehr deutlich im Gleichnis vom Verlorenen Sohn.
Der Vater fordert nichts; ihm genügt es, den Sohn
wiedergekehrt zu
sehen, um zu wissen, dass er die Umkehr vollzogen hat, dass er
verändert zurückqekehrt ist. Verändert
bedeutet ganz und
gar nicht vollkommen. Er mag sich verändert haben und dennoch
für eine lange Zeit für die Familie schwer
erträglich
geworden sein. Dem Vater genügt es, dass sein Sohn
wiedergekehrt
ist; was noch zu tun bleibt, kann man gemeinsam überwinden.
Das
Verzeihen enthält vielerlei Elemente.
Zuerst muss einer kommen und um Verzeihung bitten oder doch wenigstens
einen Schritt in diese Richtung tun;
es ist nicht schwer, zu verzeihen, wenn man glaubt, im Recht zu sein;
es ist auch nicht schwer, einen Schritt entgegen zu kommen, wenn man im
Recht ist oder sich im Recht wähnt.
Darum muss derjenige, der im Recht zu sein glaubt, den ersten
Schritt tun.
Eine Gebärde, ein unmerklicher Hinweis, dass eine
Aussöhnung
erwünscht wäre, muss genügen, diesen Schritt
zwingend zu
machen.
Dann aber muss ein solcher Versuch zur Versöhnung
bedingungslos angenommen werden, denn ein Mensch kann sich
nur ändern im Maße der Hoffnung, die wir in ihn
setzen, im Maße der Liebe, die wir ihm zu geben
vermögen und im Maß unseres Glaubens an ihn
.
In
einer Gemeinschaft stellt sich das Problem anders.
Die Tatsache, dass ein Mensch Mitglied einer Gemeinschaft ist, kann ein
Problem bedeuten, nicht nur für einen Einzelnen, sondern
für eine ganze Gemeinschaft. Dann muss die Gemeinschaft zu der
zugleich kranken und heilenden Gemeinschaft der Kirche werden: krank,
weil jeder von uns ein Sünder ist und wir alle eine zutiefst
beschädigte Gemeinschaft sind; dennoch aber auch eine
Gemeinschaft, die fähig ist Gesundheit zu vermitteln, zu
heilen, das ewige Leben mitzuteilen. Denn
keine christliche
Gemeinschaft besteht nur aus ihren sichtbaren
Gliedern: Christus ist in ihrer Mitte, der Heilige Geist ist ihr
gegeben, und ob es die Kirche in ihrer Gesamtheit oder eine kleine
Kirchengemeinde ist – in der Gemeinschaft sind Gott und
Mensch
gänzlich für einander gegenwärtig, und wir
können
in Gott die Kraft finden, die wir als Menschen nicht besitzen.
Die Erfahrung, geliebt zu werden in vollem Bewusstsein dessen wie wir sind
– nicht trotzdem, oder weil man nicht wüsste, wie wir sind – ist ein sehr herrliches Geschenk, das Anlass zu Dankbarkeit und Demut wird und das aus unserem Leben ein demütiges Voranschreiten im Gebet macht.
Doch muss die Verzeihung auch angenommen werden.
Oft meinen Menschen, keine Verzeihung annehmen zu können, weil sie sich selber nicht verzeihen können. Selber können wir uns nicht verzeihen, aber wir müssen von einem anderen Menschen die Verzeihung annehmen können, – mag vorgefallen sein was will – dass er uns zugetan bleibt; was eine wahrhaft unverdiente Gnade ist. Und das ist schwer.
Viele Menschen vermögen auch in der Absolution Gottes Verzeihung nicht anzunehmen und können nicht absolviert werden. Gott hat verziehen – aber sie haben die Absolution trotzdem nicht erhalten.
Es ist auch schwer, die Verzeihung unverdient anzunehmen.
Es kann demütigend sein. Aber wenn wir besser verstehen lernen, wenn wir zu geben lernen, lernen wir auch zu empfangen. Einer, der sich selbst nicht verzeihen lassen kann, vermag auch selbst niemals zu vergeben. Einer, der nicht annehmen kann, geliebt zu werden, anerkannt zu werden, Hingabe zu empfangen, kann auch seinerseits nicht lieben, anerkennen, Hingabe aufbringen, denn derlei geschieht wechselseitig. Unverdient zu empfangen lernt man in staunender Freude, Demut und Dankbarkeit, mit der wir eine unverdiente Gabe beantworten. Und haben wir das erst entdeckt, können auch wir zu schenken beginnen ohne uns darum dem Empfangenden gegenüber überlegen zu fühlen.
Natürlich
ist unser Verzeihen nicht Gottes Verzeihen.
Doch müssten wir lange warten, bis wir so zu verzeihen
vermöchten. Aber wir können damit beginnen zu lernen,
uns gegenseitig in all unserer Begrenztheit anzunehmen. Es ist schwer,
um Verzeihung zu bitten, es ist auch nicht leicht, zu verzeihen, doch
Verzeihung zu verweigern ist ebenfalls schwer.
Am
Sonntag vor der Großen
Fastenzeit, nach dem Verzeihungsgottesdienst, der ein Gottesdienst der
Buße und der Hoffnung ist, sollen alle Glieder einer
Gemeinschaft
einander um Verzeihung bitten.
Jahrelang habe ich die Leute ermuntert, einander zu
vergeben;
dann habe ich beobachtet, wie sie mit Wärme und Enthusiasmus
Leute um Verzeihung baten, die sie niemals beleidigt hatten;
aber sie bewiesen sehr viel mehr Zurückhaltung bei anderen,
von denen sie selber Verzeihung zu erhoffen hatten;
und schließlich sah ich sie denen den Rücken kehren,
die keinerlei Bedürfnis hatten ihnen zu verzeihen, weil sie
sich ihnen gegenüber tatsächlich allzu rüde
verhalten hatten.
– Da habe ich zunächst verlangt, dass niemand
Verzeihung von
jemand erbitten sollte, den er nicht darum bitten wollte,
– weil er noch zu keinem Frieden mit ihm gefunden hatte.
Dann sollten sie sagen: „ich bitte Sie nicht um Verzeihung,
weil
meine Einstellung sich noch nicht geändert hat. Wenn Sie mir
verzeihen ändert das nichts; ich verabscheue Sie und habe die
Absicht, Sie auch weiterhin zu verabscheuen.“
Und von denen, deren Verzeihung man erbat, die sie nicht
gewähren konnten dass sie antworten sollten:
„Ich bin sehr bekümmert, aber mein Herz ist noch zu
schwer,
ich bin noch zu bitter, ich kann Ihnen noch nicht verzeihen.“
Dann
aber wurden beide Parteien aufgefordert, sich in der Beichte vor Gott
hinzustellen und ihm zu sagen:
„Herr, ich erwarte von Dir jetzt Vergebung. Selber Vergebung
zu
gewähren, verweigere ich. Ich erwarte einen Schritt auf mich
zu,
lehne es aber selbst ab diesen Schritt zu tun .....“ Jemandem
zu
sagen, „Ich lehne es ab, zu verzeihen,“ wirkt so
erschütternd, dass die Menschen zu denken beginnen. Gesagt zu
bekommen, „ich kann dir nicht mit Überzeugung
vergeben“ ist ebenfalls erschütternd.
Wenn
in einer Gemeinschaft der Mut aufgebracht wird, wenigstens so
aufrichtig zu sein, dass man es fertig bringt, zu sagen: „Ich
bin nicht imstande dir zu verzeihen;
das heißt nicht, dass du so schlimm bist, dass ich dir nicht
verzeihen könnte, sondern, dass ich so schlimm bin, es nicht
fertig zu bringen, dir zu verzeihen“, dann wird derjenige,
der nicht verzeiht, Gegenstand der Sorge und der Fürbitte der
Gemeinschaft, mehr als der andere, dem die Verzeihung verweigert wird
– solange, bis er Verzeihung erbitten kann.
Wenn
uns ein Mensch begegnet, so ist das niemals ein zufälliges
Zusammentreffen.
Dieser Mensch muss in unserer Gegenwart, unserm Blick, der Art, wie wir
ihn behandeln, der Art, wie wir auf der Straße an ihm
vorübergehen, eine Gottesgegenwart, lebendiges Gebet
spüren.
Jemand kommt, stets ist er mir ein Gesandter des Herrn: ob er mit einer
Botschaft kommt oder mit ausgestreckter Hand – wir sind
aufgerufen, eine Liebestat zu tun, eine Tat christlicher Liebe.
Jeder
Umstand, dem wir im Leben begegnen, ist gottgewollt, wir sollen in die
Situation eintreten und Gott gegenwärtig machen durch unsere
Gegenwart und unser Gebet. Ob ein Leben erfolgreich ist oder nicht
macht wenig aus im Hinblick auf das Gebet.
Was auch kommen möge, vor jeder neuen Situation
können wir bitten:
Herr, gib mir Einsicht,
gib mir ein Herz, das fähig ist, zu antworten,
gibt mir den rechten Willen,
sei gegenwärtig in dem was hier geschieht.
Wenn ein anderer spricht, können wir ständig beten und den Herrn bitten, uns verstehen zu lehren, nicht nur die Worte, die ausgesprochen werden, sondern das tiefe Bedürfen, die Wirklichkeit, die sich hinter den Worten oftmals verbirgt. Und wenn die Zeit gekommen ist und der andere nicht mehr spricht, kann man so lange schweigen und beten, bis man etwas zu sagen weiß; und wenn einem dann ein Gedanke gekommen ist, der die Klarheit und Gewissheit der Dinge hat, die von Gott kommen, – dann können wir ihn vorbringen und hernach Gott bitten, er möchte für den anderen Menschen bewirken, was wir nicht zu bewirken vermögen, er möchte, wenn wir einen Irrtum begingen, ihn uns verzeihen und ihn heilen, und wenn der Mensch gegangen ist, weiter für ihn beten.
Die
Art, wie man eine Frage stellt,
die Art, wie man zuhört, wie man eine Entfaltung
möglich oder
unmöglich macht, ist so wesentlich.
Einen Menschen, der nichts zu antworten weiß und sich
schämt, – mit dem Gefühl
zurückzuschicken,
völlig versagt zu haben
- oder doch mit ein wenig Hoffnung und der Freude, jedenfalls als
Mensch angenommen worden zu sein.
Alles
kann im Gebet verankert sein.
Man kann lernen, sich der Gegenwart Gottes ständig bewusst zu
werden, mit einem klaren, lebendigen Gefühl, ihm zugewandt
bleiben; jedoch immer mit voller Aufmerksamkeit; denn es ist vielfach
Unaufmerksamkeit, die nach und nach die Wirklichkeit aller Dinge
zerstört...
Übersetzung
aus dem Englischen: Irene Hoening
hier aus St. Andreas Bote
Vollständiges Fasten, wie in den Grossen 40-tägigen Fasten vor dem Auferstehungsfest vorgesehen, bedeutet Abstinenz von Fleisch, Eiern, allen Milchprodukten, Fisch, Wein und Öl. Der Speiseplan besteht also praktisch nur aus Gemüse, das ohne Öl zubereitet wird, Kartoffeln, Reis und Brot, wobei den Hülsenfrüchten (Erbsen, Bohnen jeder Art, Linsen) besondere Bedeutung zur ausgewogenen Ernährung zukommt. An den Samstagen und Sonntagen dieser Fastenzeit ist laut Typikon zusätzlich Wein und Öl erlaubt, was die Zubereitung der Speisen erleichtert. An einem besonderen Feiertag, wie zum Fest der Verkündigung an die Gottesmutters am 25. März (7.4.) aber z.B. nicht am Sonntag der Orthodoxie ! sind auch Fischspeisen erlaubt.
Dabei ist jedoch immer zu bedenken, dass die Fasten keine Zwangsjacke darstellen, sondern eine Hilfe, die die Abhängigkeiten aufheben und uns auf das Gebet hin orientieren sollen.
Dadurch gehört auch weitestgehender Verzicht auf "Zeitvertreib" und Unterhaltungsmedien.
Ernsthafte Bemühungen in der Überwindung persönlicher Schwächen sind notwendige Begleiter sinnvollen Fastens.
Hingegen sollte bei gesundheitlichen Problemen wirklich nur Überflüssiges dem Fasten unterworfen werden.
Damit hier keine Willkür oder unheilsame Unsicherheit aufkommt, sollte man sich immer mit dem "Geistlichen Vater", zu dem ein jeder Christ für seinen Nächsten werden kann, absprechen !
F A S T E N
Jes 58: 4 ff
+++
Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr
und schlagt mit gottloser Faust drein.
Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr es jetzt tut,
wenn eure Stimme im Himmel gehört werden soll.
Das aber ist ein Fasten, an dem ich Gefallen habe:
Loese die Fesseln derer, die du mit Unrecht gebunden hast;
Loese die Stricke des Jochs !...
Teile mit den Hungrigen dein Brot,
und die im Elend ohne Obdach sind, fuehre in dein Haus...
Dann wird dein Licht hervorleuchten wie die Morgenroete,
und dein Heil wird schnell voranschreiten,
und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen,
und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschliessen.
Dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten.
Wenn du schreist, wird ER sagen:
Siehe, hier bin ich !
Wenn du bei dir niemanden unterjochst
und nicht mit Fingern zeigst
und nicht uebel redest,
sondern den Hungrigen dein Herz finden laesst
und den Elenden seinen Mangel linderst,
dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis
und dein Dunkel wird sein wie der Mittag.
Und der Herr wird dich immerdar fuehren
und dich satt werden lassen in der Duerre
und dein Gebein staerken.
Und du wirst sein
wie ein gut bewaesserter Garten
und wie eine Wasserquelle,
der es nie an Wasser fehlt.
+++
So singen wir am Beginn der Fasten:
+++
Lasset uns ein Fasten halten,
welches dem Herrn gebuehrt und wohlgefaellig ist:
Entfremdung von boesen Taten,
Beherrschung der Zunge,
Enthaltung von Zorn,
Fernhalten von zwanghafter Begierde,
Verleumdung,
Luege und
Meineid.
Die Freiheit von diesen Dingen
ist ein wahres Fasten.
+++
Beweise es durch deine Werke:
Wenn du einen armen Menschen siehst, habe Mitleid mit ihm.
Wenn du siehst, dass ein Freund geehrt wird, dann beneide ihn nicht.
Lass nicht nur deinen Mund fasten, sondern auch das Auge und das Ohr und die Füße und die Hände und alle Glieder des Körpers.
Die Hände sollen fasten, indem sie frei von Gier sind.
Lass die Füße fasten, indem sie aufhören, der Sünde hinterherzulaufen.
Die Augen fasten, indem sie lernen, nicht auf das zu blicken, was sündig ist.
Das Ohr soll fasten, indem es nicht auf böses Gerede und Klatsch hört.
Der Mund soll fasten, indem er sich von bösen Worten und ungerechter Kritik fernhält.
Denn was nützt es, wenn wir uns vom Essen von Hühnern und Fischen fernhalten,
aber unsere Brüder beißen und verschlingen?
Hl. JOHANNES, der Mund Goldener Worte (Chrysostomus)
Warum wir fasten ?
Prof. Dr. John Breck
Charleston,USA - Paris,St.Serge
übersetzt von G. Wolf
St.Andreas-Bote
Viele
Christen haben
die überkommene Fastenpraxis aufgegeben.
In vielen heutigen westlichen Kirchengemeinschaften scheint sie
mühsam und unwesentlich.
Für diejenigen aber, die die heilende (eschatologische) und
heiligende (sakramentale) Bedeutung des Fastens schätzen, ist
es so wesentlich wie Essen und Trinken.
Warum fasten also die orthodoxen Christen ?
Für die meisten ist das Leben schon herausfordernd genug
ohne selbstauferlegte Schranken für das, was wir an gewissen
Wochentagen und während langer Perioden des Kirchenjahres
essen,
trinken und tun.
Sorgt sich Gott wirklich darum ob wir freitags Fleisch essen oder den
Kühlschrank während der Fastenzeit von Milchprodukten
befreien ?
Ist das wirklich wichtig ?
Zusätzlich haben manche noch Bedenken wegen der
Scheinheiligkeit, die das Fasten manchmal begleitet.
Wir weigern uns aus spirituellen Gründen manche Lebensmittel
zu essen,
tun aber wenig oder gar nichts dafür, unser Verhalten
gegenüber Anderen zu ändern.
Eine mit der Fastenzeit verbundene Klage (sowohl vom Hl. BASILIOS dem
Grossen,
wie vom Hl. CHRYSOSTOMOS überliefert und von Metropolit Simeon
von
der Bulgarischen Orthodoxen Kirche auch in unserer Zeit wiederholt
gelehrt,
Anm. des Herausgebers dieser Internet-Seite) fasst das mit
erschreckender Genauigkeit zusammen:
" DU ENTHÄLTST DICH DER FLEISCHSPEISE - ABER DU VERSCHLINGST
DEINE NÄCHSTEN !"
Der Hl.JOHANNES vom Sinai hat uns die wirkliche spirituelle Gefahr
aufgezeigt, die im übermässigen Genuss liegt:
...Essen soll den Körper gesund erhalten;
aber nicht durch un-überlegte -oft von aussen
suggerierte- Wünsche
versklaven und
uns von der Sorge um unser Heil ablenken !
Die pastoralen Erfahrungen der Kirchenväter ergänzen
die biblischen Mahnungen, wie die des Hl. Apostels PAULUS:
" ... sorgt nicht so für euren Leib, dass unsinnige Begierden
erwachen " (Röm. 13,14).
Die asketische Tradition der Alten Kirche kennt mehrere Gründe
für das Fasten.
Richtiges Fasten reinigt den Körper von Giften, es erleichtert
das Gebet,
es hilft LEIDENschaften und Versuchungen zu beherrschen,
und es hilft Solidarität mit den Armen dieser Welt zu
fühlen.
Diese Tradition aber besteht auf einem Zugang zum Fasten, der heute oft
vergessen wird:
Ausgewogenheit und Masshalten.
Wir können uns zwanghaftes "Etikettenlesen" von allen
gekauften Lebensmitteln auferlegen,
nur um sicher zu sein, dass sie auch nicht eine Spur von Milch
enthalten;
wir können hungern bis unsere Gesundheit in Gefahr ist;
wir können uns hämisch freuen über unseren
"Erfolg" und die weniger Eifrigen unter uns verurteilen.
Das aber macht die Fastendisziplin zu einer Farce.
Viele Orthodoxe, die im Westen leben, stehen vor einem Dilemma, wenn
sie von Nicht-Orthodoxen eingeladen werden,
die unsere Fastenpraxis nicht kennen, oder auch von Orthodoxen, die
sich nicht darum scheren.
In diesen Fällen sind Ausgewogenheit und Masshalten besonders
gefragt.
Um Stolz auf unser Fasten zu vermeiden, ist es gesund und
vernünftig, das Gebot zur richtigen Zeit zu lockern.
" Durch die Lockerung unserer gewöhnlichen Praxis, "
rät der Hl. DIODOKOS von Photiki,
" können wir unsere Selbstbeherrschung in Demut verborgen
halten ".
Wenn wir in Gefahr sind andere mit unseren Fasten zu beleidigen, ist
der Rat des Hl. PAULUS eine gesunde Daumenregel:
" ... esst, was euch vorgesetzt wird " (1Kor 10:27)
Doch beantwortet solcher Rat nicht die Frage, warum wir gerufen
-eingeladen- sind, Fastenregeln zu akzeptieren,
sei es eine totale Abstinenz für kurze Zeit oder
eingeschränkte Nahrung während längerer
Fastenzeiten.
Evagrios Pontikos, ein georgischer Mönch, der 399 in der
Abgeschiedenheit der ägyptischen Wüste starb,
beschreibt uns die richtigen Gründe, warum das Fasten im
christlichen Leben so wichtig ist:
" Faste vor dem Herrn so gut du kannst, " rät er,
" denn damit wirst du von deinen Lastern und Sünden gereinigt;
es erhöht die Seele,
heiligt den Geist,
treibt Dämonen aus
und bereitet dich auf die Gegenwart Gottes vor
...
Sich der Nahrung zu enthalten, sollte dann deine eigene Wahl sein und
asketisches Bemühen ".
Elias, der Presbyter, ein Priestermönch des 11./12.
Jahrhunderts,
verdeutlicht dieses Ziel mit dem Bild des kommenden Reiches.
"Wer Fasten und das unablässige Gebet praktiziert,
das eine zusammen mit dem anderen,
wird sein Ziel, die Stätte aus der ´Kummer und
Seufzen entfliehen´ (Jes 35:10 LXX) erreichen ".
Fasten dient dem Heil nur wenn es in Beziehung auf das Reich Gottes
gehalten wird.
Wenn es auch dazu dienen mag den Leib zu entgiften
und uns hilft unsere Versuchungen zu Völlerei und Genusssucht
in den Griff zu bekommen,
rechtfertigt dies keineswegs ihre Strenge.
Die Fastendisziplin hat nur einen grundlegenden Zweck: uns auf das Fest
vorzubereiten.
Wir enthalten uns völlig des Essens bevor wir die Heilige
Kommunion empfangen,
nicht nur um den Bauch zu leeren,
sondern um Hunger für die wahre Eucharistie zu schaffen,
das Himmlische Mahl, das für uns bereitet wurde vor der
Erschaffung der Welt.
Das gleiche gilt für die langen Fastenzeiten unseres
Kirchenjahres.
Sie helfen sehr bei der lebenswichtigen Aufgabe, die "Zeit zu
heiligen",
Herz und Geist der überweltlichen Wirklichkeit und dem
Versprechen der erfüllten Hoffnung zu öffnen.
Fasten hat seine wahre Grundlage im gesamten sakramentalen Leben der
Kirche,
das den Gläubigen nährt und zum ewigen Leben, zu
Freude und Frieden im Himmelreich führt.
Es erhebt uns über die täglichen Sorgen unserer
irdischen Existenz,
um uns sicher auf die Flugbahn zu setzen,
die uns von diesem Leben ins nächste bringt.
Fasten ist kein Sakrament im strikten Sinne, aber es ist zutiefst
"sakramental".
Sakramental und eschatologisch, weil es unser gegenwärtiges
Leben und unser Tun heiligt,
unser Gebet -das persönliche, wie das gemeinschaftliche-
vertieft und verstärkt,
und in unserem innersten Sein einen entscheidenden Durst nach dem
versprochenen Mahl schafft, dem kommenden ewigen Fest.
Fasten ist die Mahnung, dass der Weg zur Herrlichkeit der Weg des
Kreuzes ist.
Fasten mag kleinere Unannehmlichkeiten auferlegen:
unseren Drang nach sofortiger Befriedigung enttäuschen
und uns schmerzlich daran zu erinnern, wieviele der Menschen dieser
Erde jede Nacht hungrig zu Bett gehen.
Aber das alles hat sein Gutes.
Denn diese Unannehmlichkeiten führen den Leib, den Geist und
die Seele zu dem, was wirklich wichtig ist:
zum himmlischen Jerusalem
in dem die Seele erhöht wird,
der Geist geheiligt
und die Dämonen besiegt,
und wir alle auf ewig in der Gegenwart Gottes weilen.
Quelle: http://www.holyapostles.org
* St. Andreas Bote:
empfehlenswerte Monatsschrift in deutscher Sprache mit ausgewählten aktuellen Texten der besten Theologen aus allen orthodoxen Traditionen und aktuellem Kalendarium
Fragen, Zuschriften an G.Wolf, Dammweg 1, 85655 Grosshelfendorf, 08095 - 1217; gerhard.wolf@t-online.de
jetzt auch online !
St. Andreas Bote - online
Herr und Gebieter meines Lebens,
Gib mir nicht den Geist des Müßiggangs, des Verzagens,der Herrschsucht und der Geschwätzigkeit.
Schenke vielmehr mir, Deinem Diener, den Geist der Keuschheit, der Demut, der Geduld und der Liebe.
(еine große Verneigung)
Ja, Herr, mein König,
gewähre mir, meine Sünden zu sehen
und meinen Bruder nicht zu verurteilen,
denn gesegnet bist Du in alle Ewigkeit,
Amen.
Das Gebet des Hl. Ephraim des Syrers
1) Faulheit (Müssiggang)
Der Geist der Faulheit (man kann dieses Wort im Original sehr verschieden übersetzen) hat in erster Linie mit dem Zustand unserer Seele zu tun, wenn in ihr kein Leben ist, wenn sie so vor sich her schlummert und erkaltet ist. Er ist ein Ausdruck für Leere in uns. Es ist die Leere, die das Evangelium mit einem leeren Haus bezeichnet, aus dem der böse Geist vertrieben worden ist. Es ist aufgeräumt, sauber und bereit, Gäste zu empfangen. Und doch ist es leer. Und das Evangelium sagt weiter, wie dann der vorher vertriebene böse Geist zurückkehrt und, wenn er nun sieht, dass es sauber und aufgeräumt ist, andere sieben noch furchtbarere Geister ruft und diese sich wieder in dieses leere Haus einnisten (Mt. 12,43-45). Das ist eine Warnung an uns. Wenn unsere Seele leer ist, wenn unser Herz leer ist und unser Verstand, wenn unsere Worte leer sind, ohne Geist und Leben - das doch eigentlich Dem gehört, Den wir als unseren Herren und Gebieter bekennen - dann ergreift sie, dann erfüllt sie etwas anderes. Deshalb ist das erste, wovor uns der Herr bewahren soll, der Geist der Faulheit, der Schläfrigkeit, der Leere – wie viele Wörter bezeichnen ein dasselbe – der der Grund für jegliche Zerstörung ist.
2) Die Verzagtheit.
Wenn wir in uns diesen Zustand, den ich gerade beschrieben habe, feststellen, dann sollten wir irgendwie handeln. Dafür bedarf es Entschiedenheit und Mut. Doch wir verzagen. Es ist so einfach auf etwas Besseres zu hoffen und doch so schwer, sich von der Stelle zu rühren. Es ist viel einfacher auch weiterhin in einer Welt der Illusionen zu leben, als wirklich aufzuwachen. Doch ein wirklicher Held ist der, der aufgewacht, der von sich schüttelt alle Schläfrigkeit, wer wirklich wachsam ist. Es ist derjenige, der nach den Worten vom Heiligen Serafim von Sarow entschlossen ist, lieber seine Ruhe und alles, was ihm teuer ist, entbehren zu müssen, als ohne Gott zu leben. Darin besteht der einzige Unterschied zwischen einem Sünder, der an seiner Sünde zugrunde geht, und einem Heiligen, der seiner Berufung gerecht wird, weil er Verzagtheit und Trübsinn in sich überwindet.Trübsinn ist Schlummern sehr ähnlich. Man lässt alles laufen, wie es so geht. Man flüchtet sich lieber eine Traumwelt, in eine virtuelle Welt, in die Illusionen. Der Schlummer wartet nicht auf die Nacht. Man schließt die Augen und könnte denken, es ist Nacht und Zeit zum Schlafen. Und ist es nicht merkwürdig, dass gerade dann, wenn uns die Kraft nicht ausreicht, etwas zu tun, wir uns voller Stolz in eine Welt der Macht und des Erfolges träumen? Wenn wir aber beschäftigt sind mit einer Sache, die unsere gesamte Aufmerksamkeit erfordert, dann ist das erste, was wir uns erträumen, die Sache auch zu leiten, dann erwacht in uns der Hunger nach Macht, dann treibt uns der Stolz. Neben unserer Verzagtheit steht unsere Feigheit, stehen Schlaffheit und ein Leben in Illusionen. Und in diesen Illusionen träumen wir von Macht, von Stärke und die damit verbundene Grausamkeit und Grobheit.
3) Geschwätzigkeit.
Es geht nicht darum, dass wir viel reden. Natürlich ist auch das damit gemeint. Doch es geht vielmehr um die Nichtigkeit unserer Worte. Unsere Worte tragen keine Früchte. Diese Fruchtlosigkeit wurzelt in Verzagtheit, Trübsinn und Träumerei, die zu Machthunger führt. Und so reden wir, wenn es eigentlich nicht sein sollte und leben in unserer Phantasie, statt in der realen Welt. Dies ist sehr wichtig, denn die Welt Gottes ist die Welt der Wirklichkeit. Die Welt des Satans ist die Welt der Illusionen, die virtuelle Welt. Die Welt Gottes ist ganz real und in ihr bestehen all die Schwierigkeiten und die Grausamkeiten der realen Welt. Der Satan schlägt uns eine Welt vor, in der nichts wirklich ist, obwohl alles möglich erscheint. Wir fühlen uns dann stark. Unser Stolz ist befriedigt. Wir können uns innerlich rühmen. Wir können uns anders denken, als wir in Wirklichkeit sind. Wir sind wichtig und mutig, obwohl wir noch nichts getan haben. Wir schlafen und die wirkliche Welt gehört denen, die wach sind.So geht es in den ersten Worten des Gebets um das Allerwichtigste. Wenn ich Gott als meinen Herrn und Gebieter anerkenne, wenn ich mich bemühe, in der Wirklichkeit zu leben, wenn ich darum ringe, die dämonische Welt der Phantasie und Virtualität von mir zu stoßen, wenn ich mit allen Kräften versuche, wirklich zu leben, um dem Tod zu entkommen – denn Leben und Wirklichkeit gehen Hand in Hand, so wie der Tod zusammen mit der Illusion – dann sollte ich begreifen lernen, was konkret und ganz real diese Worte bedeuten: Sie beschrieben nicht nur einen Zustand in der Seele, sie sind vielmehr ein Programm zum Handeln, denn jedes dieser Worte sollte für uns eine Herausforderung darstellen, eine Losung, eine Devise, die uns dazu zwingt, auf bestimmte Weise zu agieren.Wie? – das verraten uns kurz die nächste Zeile: Gib mir, Deinem Knecht, vielmehr einen Geist der Keuschheit, der Demut, der Geduld und der Liebe.
4) Keuschheit ist nicht nur eng in ihrem Bezug auf unseren Leib zu verstehen, so wie auch Jungfräulichkeit nicht nur ein physischer Zustand ist. Keuschheit beginnt in dem Moment, in dem wir uns der erstrangigen Wertmaßstäbe bewusst werden und uns um sie bemühen: um Gott und um den Menschen, wenn wir in unserem Verhältnis zu Gott und zu dem Menschen (uns selbst eingeschlossen) ehrfürchtig auftreten, wenn wir unseren eigenen Leib so ehren, wie wir es mit dem Brot und Wein tun, die sich in den Leib und das Blut Christi verwandelt haben, wie wir den Leib des Mensch gewordenen Gottes verehren würden und daraus schlussfolgernd jeden ehren würden, dem wir begegnen. Keuschheit beginnt damit, dass wir begreifen, dass jeder Mensch zur Ewigkeit berufen ist, dass er wertvoll ist in den Augen Gottes, dass er das Heil erlangen aber auch ins Verderben stürzen kann. Der Mensch kann ein Objekt der Verehrung sein und wir sind dazu aufgerufen, wie Christus gesagt hat, als er Seinen Jüngern die Füße wusch, dass auch wir einander die Füße waschen, dass wir einander treu sein und einander in Demut und Liebe dienen sollten. Nur wenn wir in einem solchen Geist leben, können wir ihn im gesamten Menschen zum Blühen bringen: in der Seele, im Leib und einen solchen Zustand der Seele, des Verstandes und des Herzen erreichen, der uns zu einer völligen und ständigen Reinheit des Leibes führt, was wir dann als Keuschheit bezeichnen.
5) Demut ist etwas viel Größeres als die traurige Karikatur, die wir oft darstellen. Es scheint uns, dass Demut darin besteht, dass wir uns immer wieder einreden, keiner Beachtung durch andere würdig zu sein, obwohl wir in Wirklichkeit so nach ihr dürsten. Oder wir behaupten, dass wir etwas Unwichtiges geleistet haben, obwohl wir eigentlich wissen, dass wir etwas Gutes und Wichtiges getan haben. Es hätte aber keinen Wert, weil wir es getan haben. Das ist keine Demut. Wirkliche Demut heißt in erster Linie, sich selbst zu vergessen und sich dabei ernsthaft, tiefgreifend und kreativ um Gott und seinen Nächsten zu kümmern. So, dass wir gar kein Interesse daran haben, uns auf uns selbst zu konzentrieren. Es ist ein Zustand, in dem wir, wenn wir uns plötzlich wichtig nehmen, zu uns sagen: Geh mir aus dem Weg! Du bist kleinlich und niedrig und so uninteressant! Ich möchte mich mit sehr viel Wertvollerem beschäftigen!Demut hängt auch mit dem Sieg über unsere Sucht nach Anerkennung und über unseren Stolz zusammen.
6) Demut steht in Verbindung mit Ruhmsucht. Nicht nur, weil sie ganz offensichtlich ihr Gegenteil darstellt. Ehrsüchtig ist vielmehr der, der nach Anerkennung in den Augen der Menschen strebt, nicht aber von Gott. Wenn man aber bedenkt, von welchen Menschen wir uns Anerkennung erhoffen oder wofür wir gerne gelobt werden wollen, dann sehen wir, wie niedrig wir uns selber machen durch diese Sucht nach Anerkennung. Der Anlass für diese Ruhmsucht kann etwas sehr Unbedeutendes sein: ein Witz, ein Erfolg, der eigentlich in keinem Verhältnis zur eigentlichen Größe des Menschseins steht. Es kann sein, dass wir sogar denjenigen, die uns verachten, aber trotzdem beklatschen, noch dankbar sind für ihr Lob. In beiden Fällen, sei es nun wegen des Anlasses oder wegen der Leute, macht uns die Ehrsucht zu unwahrscheinlich kleinen, leeren Wesen, die eigentlich zu nichts Nütze sind. Sie führt uns zur Nichtigkeit. Demut beginnt vielmehr da, wenn wir anfangen, unsere Urteile nicht mit denen der Menschen zu vergleichen, mit den oberflächlichen und zufälligen Bemerkungen der Leute, sondern mit der wahren Größe des Menschseins, mit der Fülle der Wahrheit Gottes. Demut besteht darin, kein anderes Maß für sich anzunehmen, als nur die Größe des Menschseins vor dem Urteil Gottes.Das ist der Grund, warum die Heiligen demütig waren, warum sie begriffen hatte, wie groß der Mensch ist und gleichzeitig, wie weit sie selbst von ihrer Berufung entfernt waren. Denn sie wussten, dass uns die die wirkliche Größe des Menschen in Jesus Christus offenbart worden ist (Röm. 5,15). So konnten sie mit wahrer Demut sich eingestehen, wie unwürdig sie doch selbst waren. Denn sie wussten, dass Gott wollte, dass wir Seine Freunde seien, Seine engen Weggefährten. Und so konnten sie auch das ganze Ausmaß und die Tiefe unseres Falls begreifen und den Abgrund zwischen uns und Ihm ermessen und so ihrer Demut beweisen. Aus der Schau der Größe des Menschen und der Herrlichkeit Gottes wird im Menschen die Demut geboren. Nicht aber aus dem ständigen Sich Bewusstmachen der eigenen Misserfolge oder der eigenen Unwürdigkeit. Darüber habe ich schon einige Male gesprochen: Demut, im englischen humility kommt vom lateinischen Wort „humus“. Fruchtbarer Boden. Dies ist ein sehr passendes Bild. Die Erde, der Boden ist immer da. Auf ihm gehen wir und er lässt mit sich machen, was wir wollen. Er nimmt unseren Müll an, aber auch lebendigen Samen und Sonnenstrahlen und Regen. Er kann alles aufnehmen und daraus Früchte hervorbringen. Man denkt nicht an ihn. Er schweigt. Er hält alles aus und bringt doch Frucht. Darin besteht Demut.
7) Geduld ist ein anderes gehaltvolles Wort. Es ist nicht nur die Fähigkeit geduldig seinen Nächsten zu ertragen. Es ist die Fähigkeit, Leid auszuhalten, Schwierigkeiten, Einschränkungen, beliebige Lasten zu tragen, angefangen von sich selbst bis hin zum Tod am Kreuz. Geduld bedeutet Kraft, Glauben, Schweigen. Dies alles führt uns auch zur Liebe und beginnt in der Liebe. Liebe ist die Fähigkeit alles zu geben, was man hat: auch sich selbst. Es ist die Fähigkeit, den anderen voller Ehrfurcht in seinem Anderssein anzunehmen, voller Verehrung und Freude. Es ist die Fähigkeit, sein Leben für seine Freunde hinzugeben und Opfer zu bringen. Wenn hier Parallelen zu dem vorher Gesagten gezogen werden sollen – und das schlage ich euch vor, selber zu tun – kann man sehen, dass in der Liebe die Antwort auf die ersten vier Bitten enthalten ist. So lebt der, der für die Wirklichkeit erwacht ist, der vor dem Angesicht Gottes und des Menschen, vor sich selbst und vor seiner eigenen Berufung wandelt, der bereit ist, zu handeln und der all dies als Grund und als Endziel betrachtet, mit Liebe, denn sie ist die Fülle des Lebens.Und am Ende beten wir, obwohl wir damit auch hätten beginnen können, denn für Ephrem dem Syrer war dies vielleicht die gewohnteste Erfahrung des Lebens: Herr und König, lass mich meine eigenen Sünden erkennen und nicht meinen Bruder verurteilen!
Amin.
(Entnommen dem Buch: „Durch das Kirchenjahr“ von Metropolit Anthony (Bloom)
SONNTAGE der Fastenzeit:
1. Sonntag: Fest der ORTHODOXIE 1.3. 2026
2. Sonntag: Hl. GREGOR Palamas 8.3. 2026
3. Sonntag: KREUZVEREHRUNG 15.3. 2026
4. Sonntag: Hl. JOHANNES von der Himmelsleiter 22.3. 2026
5. Sonntag: Hl. MARIA von Aegypten 29.3. 2026
Am 1. Sonntag der Grossen Fasten feiern wir das
FEST der ORTHODOXIE
|
Das
unbegrenzte Wort des
Vaters nahm die Grenzen der Gestalt an durch die Fleischwerdung in Dir, o Gottesgebaererin. In Dir wurde das befleckte Abbild in den urspruenglichen Zustand verwandelt und erfuellt mit der goettlichen Schoenheit des Urbilds. Wir aber, indem wir das Heil erkennen, stellen dies dar in Werk und Wort . |
|
Predigt von Metropolit ANTHONY
(Bloom) von SUROSH (London)
=Sunday
of Orthodoxy=
Histor.Entwicklungen
und Ikonentheologie des Hl. JOHANNES von Damaskus
787 definierte die Kirche die genaue Bedeutung der Ikonen und ihre Verehrung. 843 setzte ein von Kaiserin Theodora einberufenes Konzil der Verfolgung ein Ende und gab den Glaeubigen auch offiziell die Ikonen wieder. Seither wird dieses Fest am ersten Sonntag der Grossen voroesterlichen Fasten gefeiert.
Das heutige Fest kann nicht als gegen die anderen christlichen Kirchen im Westen gerichtet verstanden werden. Die Kirche im Westen und außerhalb des byzantinischen Reiches hat in dieser Zeit an den Bildern festgehalten und war so gesehen "orthodox" geblieben, waehrend der Bildersturm im Ostroemischen Reiche wuetete. Der Westen musste keinen Bildersturm erleben - aber er kennt deshalb auch keine theologische Begründungen, Richtlinien und Grenzen für religiöse Darstellungsformen.
Predigt
von Metropolit ANTHONY (Bloom) von SUROSH
Was ein Kirchenfest den Menschen von heute sagen will
Wenn wir uns gegenwaertig umschauen und tief hinein in die uns so vertraute und werte Orthodoxie blicken, wieviel Schlaffheit und Bedruecktheit sehen wir dort, wie wenig von dem, was wie ein Triumph aussieht. Freilich triumphieren wir gar nicht so sehr ueber den sichtbaren Ruhm der Orthodoxie. Ihren Sieg sehen wir vielmehr in zwei Bereichen.
Das Fest der Orthodoxie
indes wurde aufgrund eines besonderen Vorfalls
gestiftet.
Es reicht zurueck in die Zeit nach dem Siebenten Oekumenischen Konzil,
als die Orthodoxie endgueltig ueber den Bildersturm gesiegt hatte.
Worum handelt es sich dabei ? Darum, dass die Kirche das Recht und
unsere Pflicht verteidigt hat, den Ikonen Christi, der Gottesmutter und
der vielen Heiligen Verehrung zu erweisen. Damit hat sie die Wahrheit
der Inkarnation verteidigt; jene Wahrheit, dass Gott Sich Selbst
offenbart, Sich sichtbar dastellt, vielleicht nicht voellig, aber Er
zeigt Sich uns in den Bildern, die wir von Ihm geschaffen haben.
Die Liturgie des heiligen
Basilius des Grossen spricht von Christus, Er
sei das Bild der Ebenbildlichkeit, das uns den Vater offenbart. Er ist
ein vollkommenes Bild. Er -IST- die Wahrheit. Er ist vollkommener Gott
wie auch vollkommener Mensch. Ja selbst in uns ist ein Abglanz dieses
Bildes geblieben.
Nicht ohne Grund haben die Kirchenvaeter gelehrt:
Wer seinen Bruder sieht, der sieht Gott.
Amin.
FASTENBRIEF 2005
der orthodoxen Bischöfe Deutschlands
Liebe Väter, Brüder und Schwestern in Christus,
für uns
orthodoxe Bischöfe, die wir Mitglieder der KOKiD sind, ist es
eine große Freude, Euch, unseren geistlichen Kindern,
an diesem Sonntag derOrthodoxie diesen Hirtenbrief zu senden, in dem
wir versuchen, eure Aufmerksamkeit auf einige bedeutende Aspekte
unseres orthodoxen Glaubens zu lenken.
Als Orthodoxe
hören wir nicht auf, immer wieder zu erklären, dass
die Orthodoxie die Kirche Christi ist, die „eine heilige
katholische und apostolische“ Kirche, die sich mit Christus
identifiziert, insofern sie sein Leib ist und er ihr Haupt (Eph 1, 23).
Als Kirche der Apostel und der Väter bewahrt die Orthodoxie
treu den Glauben, den diese formuliert und weitergegeben und
für den im Laufe der Jahrhunderte unzählige Martyrer
ihr Leben hingegeben haben.
An diesem
„Sonntag der Orthodoxie“ gedenken wir ganz
besonders unserer Brüder und Schwestern, die im Laufe des 8.
und zu Beginn des 9. Jahrhunderts unter Einsatz ihres Lebens
für die Verteidigung der heiligen Ikonen gekämpft
haben.
Das war jene Zeit, da die bilderstürmerischen Kaiser die
Ikonen zerstörten und der Kirche einen Gott ohne Angesicht,
einen fernen Gott,
einen in seiner Transzendenz verschlossenen Gott aufzwingen wollten,
was in der letzten Konsequenz eine Begegnung mit dem Menschen, seinem
in Wirklichkeit konkreten und oft unglücklichen Abbild,
unmöglich gemacht hätte.
Dies bedeutete, den Glauben selbst zu zerstören, denn im Herzen der christlichen Botschaft steht zu Recht die Inkarnation: Gott überwindet seine eigene Transzendenz und wird Mensch; in Christus, seinem geliebten Sohn, nimmt er menschliche Gestalt an, um von allen als ein naher Gott erkannt zu werden, als ein barmherziger Gott, der „jede Träne von jedem Gesicht abwischt“ (Paraklesis zur Gottesmutter).
Die Ikone Christi
– und mit ihr verbunden die Ikone der Gottesmutter und jedes
Heiligen – bezeugt wahrhaft diese unendliche Liebe Gottes,
„der seinen Sohn hingegeben hat, damit ein jeder, der an ihn
glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe“
(Eucharistisches Hochgebet). Mehr als ein bloßes sichtbares
Zeichen, das an die Nähe Gottes erinnert, ist die Ikone auch
ein Ort der Gnade, eine Gegenwart im Mysterion.
Wenn wir sie mit Glauben im Gebet verehren, versetzt uns die Ikone in
die Gemeinschaft mit Gott oder mit den dargestellten Heiligen und
überträgt auf uns die göttlichen Energien,
mit denen sie gefüllt ist. Das ist der Grund, warum unsere
Kirchen voll sind von Ikonen und Fresken, die Christus, die
Gottesmutter, die Engel, die Heiligen und auch die biblischen
Geschehnisse und jene der heiligen Geschichte darstellen.
Immer wenn wir wieder in eine Kirche kommen, haben wir das Gefühl, auf mystische Weise von den Myriaden der Engel und Heiligen umgeben zu sein, die hier gegenwärtig sind, um mit uns zu beten und um uns zu unterstützen in unseren Bedürfnissen und unseren Leiden. Wirklich, die Kirche ist die „Gemeinschaft der Heiligen“, „Gott ist gelobt in seinen Heiligen“, wie es der Psalmist David sagt. Und wir, auch wir, sind zur Heiligkeit berufen. Mehr noch, von unserer Taufe an sind wir heilig. Zwar muss diese Heiligkeit der Taufe immer wieder durch eine persönliche Anstrengung aktualisiert werden,eine Anstrengung, die oft sehr schwer zu erreichen ist. Denn es ist nicht immer leicht zu beten, zu fasten, regelmäßig an der Göttlichen Liturgie teilzuhaben oder seine schlechten Gewohnheiten zu überwinden, um dahin zu kommen, dass wir Gott lieben aus ganzem Herzen und den Nächsten wie uns selbst. Das christliche Leben ist ein alltäglicher asketischer Kampf, ein Kampf gegen die dämonischen Mächte, die versuchen, uns fernzuhalten von Gott, uns dazu zu bringen, die Liebe Gottes für uns zu ignorieren und zu leben, ohne auf sie zu achten.
Aus diesem Grunde vergleicht der hl. Paulus das Leben des Christen mit den Athleten, die sich eine strenge Askese auferlegen, um so eine vergängliche Krone zu erlangen. Eine solche Askese ist von daher noch viel notwendiger, um das ewige Leben zu erlangen. In unserem Kampf gegen die bösen Leidenschaften, die von den Dämonen gefördert werden, nehmen das Gebet und das Fasten einen ganz zentralen Platz ein. Der Herr selbst belehrt uns, dass man sich nicht von der Herrschaft der bösen Geister befreien kann, außer durch das Gebet und das Fasten (vgl. Math 17, 21). Die Orthodoxe Kirche ist in besonderer Weise eine Kirche des Gebetes und der Askese.
Unsere Väter im Glauben haben uns ein reiches liturgisches Erbe hinterlassen, eine tiefe mystische und asketische Tradition, die immer aktuell ist, denn sie antwortet auf die Bedürfnisse und die Forderungen jedes Menschen, der Gott sucht.
Besonders die Göttliche Liturgie, die durch ihre Schönheit „der Himmel auf Erden“ ist, muss sich im Zentrum des Lebens eines jeden Christen befinden. An der Göttlichen Liturgie regelmäßig, wenn möglich jeden Sonntag, teilzunehmen, ist schon eine Askese, zumal unsere Gottesdienststätten sich oft weit entfernt von unseren Wohnungen befinden. Jeden Tag so viel wie möglich zu beten und besonders sich auch zu bemühen, die Qualität seines Gebetes zu steigern, d.h. mit voller, im Herzen konzentrierter Aufmerksamkeit zu beten, wie uns die Väter lehren, ist ebenfalls eine große Askese, so wie auch das Fasten, sei es nun das eucharistische Fasten oder das Fasten an den Mittwochen und Freitagen oder in den Fastenzeiten des Jahres.
Wir haben jetzt die Große Fastenzeit begonnen, die uns vorbereitet auf das Fest der Auferstehung des Herrn. Es ist eine Zeit der Buße, der Wiederversöhnung mit Gott und unserem Nächsten durch die Beichte unserer Sünden vor dem Priester. Das Fasten, das wir während dieser Zeit ein jeder gemäß seiner eigenen Kräfte praktizieren, hilft, in uns den Kampf der Leidenschaften zu besänftigen, den Geist zu reinigen und uns zu helfen, dass wir uns auf das Herz konzentrieren. So wird das Gebet, das vom Fasten begleitet ist, immer mehr zu einem reinen Gebet werden, ohne andere Gedanken als nur die Gedanken an Gott. Fasten bedeutet auch, dass wir unsere Güter mit unseren Brüdern teilen, die sich in Not befinden.
Somit haben also unser Gebet und all unsere asketischen Anstrengungen zum Ziel, dass wir die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten erlangen. Ein Heiliger wird gerechterweise der genannt, in dem die Liebe alles überwindet, jeden Hass und jede schlechte Leidenschaft. Der Heilige triumphiert sogar durch die Gnade über seine eigene Natur; er ist ein umgestalteter Mensch, ein befriedeter Mensch, ein geeinter Mensch, der in sich die ganze Menschheit und den ganzen Kosmos vereint. Im Heiligen verehren wir zu Recht das heiligende Werk Gottes, denn letztlich ist alles Gnade. Und jede Ikone, der wir begegnen, ist eine Einladung zur Heiligkeit.
Wir wünschen Euch allen ein gesegnetes Fasten und rufen den Segen
des Herrn auf Euch, auf Eure Kinder und Eure Familien herab.
Berlin, am Sonntag der Orthodoxie 2005
+ Metropolit
AUGOUSTINOS von Deutschland
Griechisch-Orthodoxe
Metropolie von Deutschland
+ Metropolit
GABRIEL von West- und Mitteleuropa
Metropolie
der Griechisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien für West- und
Mitteleuropa
+ Metropolit
SIMEON von West- und Mitteleuropa
Bulgarische
Diözese von West- und Mitteleuropa
+ Erzbischof
LONGIN von Klin
Ständige
Vertretung der Russischen Orthodoxen Kirche in Deutschland
+ Erzbischof
FEOFAN von Berlin und Deutschland
Berliner
Diözese der Russischen Orthodoxen Kirche des Moskauer
Patriarchats
+ Bischof
KONSTANTIN für Mitteleuropa
Serbische
Orthodoxe Diözese für Mitteleuropa
+ Metropolit
Dr. SERAFIM von Deutschland, Zentral- und Nordeuropa
Rumänische
Orthodoxe Metropolie für Deutschland, Zentral- und Nordeuropa
+ Erzbischof
IOAN von Parnassos
Ukrainische
Orthodoxe Eparchie von Westeuropa
+ Metropolit
ABRAHAM von Westeuropa
Westeuropäische
Diözese der Georgischen Orthodoxen Kirche
+ Erzbischof
GABRIEL von Komana
Exarchat
der orthodoxen Gemeinden russischer Tradition in Westeuropa
Fastenbotschaft 2006 Naechstenliebe
Historische Argumente und Entwicklungen
im "Bilderstreit"
und die
Ikonentheologie des Hl. JOHANNES von Damaskus
Die
Bilderstürmer (Ikonoklasten) störte an den
Bilderfreunden
(Ikonodoulen) nicht nur Mißbrauch oder Übertreibung
der
Bilderverehrung, sondern es spiegelt sich in dieser Auseinandersetzung
die Endphase eines langen Ringens um die richtige Christologie.
Die Ikonoklasten meinten, dass die göttliche und die
menschliche
Natur in der Person Christi doch nur geglaubt, aber nicht abgebildet
werden könne. Wer die menschliche Natur aber isoliert
darstellen
wolle, versündige sich gegen die Doppelnatur Christi. Die
Vorstellung, die in Christus vorhandene göttliche Natur habe
den
Vorrang, und anstelle der menschlichen Seele habe der Logos dominiert
fand ihren Ausdruck in der Meinung Christus sei eine reale Vermischung
(Realmonophysitismus).
Dagegen hat sich das Konzil von Nicaea 325 gewendet.
Das 4. Allgemeine Konzil von Chalkedon hat 451 die Lehre von den beiden
selbständig und komplett in Christus vorhandenen Naturen
(Duophysitismus) nochmals betont und erneut als Glaubensbekenntnis
festgelegt. In den orientalischen Regionen des Römischen
Reiches
wurde am Monophysitismus dennoch festgehalten. In der
Äthiopischen
Kirche, in der Syrisch-orthodoxen Kirche und in der Koptisch-orthodoxen
Kirche haben sich Formen des Monophysitismus bis heute erhalten. In
welchem geistigen und theologischen Umfeld Christusbilder oder andere
religiöse Darstellungen zu rechtfertigen seien und wie sie
verstanden werden sollten, war noch nicht wirklich durchdacht oder
definiert. In der Bilderfrage drifteten der Osten und der Westen immer
weiter auseinander, und aus politischen Gründen kam es im 8.
Jahrhundert in der geographischen Mitte der damaligen Christenheit, im
Oströmischen - von uns heute Byzantinisch genannten - Reich
zum
Eklat.
Der sogenannte "Byzantinische Bilderstreit"entwickelte
sich
rasch von einer Theoriediskussion zum Bürgerkrieg
(Ikonoklasmus,
von klazo = ich zerstöre). Was jahrhundertelang eine
theologische
Kontroverse und ein theoretischer Konflikt war, triftete aus
politischen Gründen auf einen Bilderstreit zu, der sich zum
Bürgerkrieg entwickelte.
Der richtige Glaube war damals noch nicht zur Privatsache
abgewertet, theologische Fragen nicht nur ein Diskussionspotential
für Gebildete.
Die richtige Interpretation des Christentums war ein reales Anliegen
für jeden Bürger.
Grundlage für den byzantinischen Staat war das
römische
Gesetz "Cunctos populos" aus dem Jahre 380: Wer nicht den rechten
Glauben hat (Häretiker), kann nicht Reichsbürger
sein.
Nachdem Kalif Jezid II. 721 alle Bilder aus Kirchen und
Öffentlichkeit in seinem Herrschaftsbereich hatte entfernen
lassen
breitete sich diese materiefeindliche Ansicht auch unter den
Intellektuellen im byzantinischen Herrschaftsbereich aus und Kaiser
Leon III. (717—741), selbst aus Kleinasien stammend, wo schon
im
7. Jahrhundert verstärkt bilderfeindliche Tendenzen
ausgebrochen
waren, ordnete 726 erste Zerstörungen von religiösen
Bildern
an, eine Versammlung kaisertreuer Beamter formulierte die theologische
und juristische Verurteilung der Bilder.
Ein kaiserliches Edikt erklärte 730 den Bildergebrauch als
strafbar. Patriarch Germanos von Konstantinopel, der dagegen
protestierte, wurde abgesetzt, sein orthodoxer Nachfolger enthauptet.
Auch Papst Gregor III., der schon damals den später "orthodox"
genannten Standpunkt vertrat, exkommunizierte alle Ikonoklasten.
Mittelitalien schied aus dem Reich des Kaisers aus. Loyalität
zum
Kaiser stand gegen Freiheit der Kirche.
Unter Konstantin V. (741-775) wandte sich die gesteigerte gewaltsame
Verfolgung auch gegen die Verehrung der Heiligen und der Gottesmutter,
Moenche wurden zur Heirat gezwungen, Klöster zu Kasernen
missbraucht. 50 000 griechische Mönche flohen nach Italien, an
die
nicht von Byzanz beherrschten Küsten des Schwarzen Meeres,
Zypern,
Syrien und Palästina. Der Kaiser berief gleichgesonnene
kirchliche
Würdenträger zu einem Konzil in seinem Palast.
Erwartungsgemäß wurden die Bilder verurteilt und
ihre
Zerstörung angeordnet. 766 mußten sich alle
Bürger
durch Eid verpflichten, einem Bild nie wieder die Proskynese zu
erweisen.
Zwei Themenbereiche mußten geklärt werden, bevor das
Ringen
um die "Rehabilitierung" der Bilder wieder aufgenommen werden konnte:
Welches ist das richtige Bild Christi?
Welche Verehrung kommt wem zu?
Zu groß war die Befürchtung, das Bild selbst
könne
Gegenstand der Verehrung sein. Im antiken Denken war im
Götterbild
die Kraft der Gottheit, mancher mochte das Abbild selbst für
das
Urbild halten.
Schon im 2. Jh. hatte sich Kirchenvater Klemens von Alexandrien
darüber Gedanken gemacht:
"Ist das Urbild nicht gegenwärtig, kann das Ebenbild denselben
Glanz ausstrahlen.
Ist die Wirklichkeit jedoch präsent, wird selbst das Bild noch
von ihrem Glanz übertroffen;
die Ähnlichkeit bleibt jedoch bestehen, enthüllt sie
doch die Wahrheit."
Ein ganz entscheidendes, weil bis dahin nie geklärtes Problem
mußte weiterhin die Frage sein, an wen sich die vor den
Bildern
offensichtlich Verehrung wendete. Das Risiko war zu groß,
daß die kultische Verehrung, die Gebete, der Weihrauch oder
das
sich Niederwerfen (Proskynese), die ja nur dem Urbild zukommen konnte,
allmählich auf das Abbild übergehen konnte.
Die Verteidiger und Freunde der Bilder (Ikonodoulen) wehrten sich gegen
den Vorwurf des "Holzanbetens", und der Bischof von Rom wurde ihr
Wortführer. Papst Gregor II. (715-731) hat in zwei Synoden die
bilderfeindlichen Bestrebungen zurückweisen lassen und sich
deswegen mit Kaiser Leon III. heftig überworfen. Den
kaiserlichen
Vorwürfen entgegnete er:
"... Ihr
sagtet: ,Steine und Wandbewurf
betet ihr an!´
Nicht so ist es, o Kaiser, wie Ihr behauptet.
Wir verehren die Bilder, weil sie uns Denkhilfe und Anregung sind, und
weil sie unser erdhaftes, sinnengebundenes Denken zur Höhe
ziehen
- und deshalb haben sie ihren Namen und Gebetsinschriften und Formen.
Wir aber beten sie nicht an als Götzenbilder, wie Ihr
behauptet; ferne sei das.
Denn wir gründen unsere Hoffnung nicht auf sie, sondern wenn
wir ein Bild des Herren anschauen, beten wir:
"Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme Dich unser und rette uns!"
Und beim Anblick des Bildes seiner heiligen Mutter sagen wir:
"Heilige Gottesgebärerin, Mutter des Herren, flehefür
uns bei
Deinem Sohn, unserem wahren Gott, dass er unsere Seelen rette!"
Und vor einem Märtyrerbild:
"Heiliger Stephanus, Du Erzmärtyrer, Du hast für
Christus
Dein Blut vergossen und darfst darum freimütig zu ihm
sprechen,
bitte für uns!"
So beten wir vor den Bildern aller Blutzeugen, solche und
ähnliche
Gebete senden wir zum Himmel durch ihre Fürbitte...
Für die Ikonoklasten war die Eucharistie die einzig legitime
Abbildung Christi. Die Ablehnungen der bilderfeindlichen Synode 754
kreisen um das Christusbild und gipfeln in der Feststellung und im
Vorwurf, daß ein ehrgeiziger Maler zwar nach
künstlerischen
Vorstellungen den menschlichen Körper Christi darstellen
könne, nicht aber dessen unsichtbare und damit nicht
abbildbare
göttliche Natur. Sollte er diese beiden vermischen wollen,
werde
er zu einem Häretiker. Dies war auch eine deutliche Abgrenzung
gegen monophysitische Vorstellungen.
Während der folgenden langen Auseinandersetzung versammelten
sich
die Bilderfeinde (Ikonoklasten) zu einem Konzil 754 in Hiereia
(Kleinasien). Wichtigster Kritikpunkt war die unwiderlegbare Tatsache,
daß das Nebeneinander der göttlichen und
menschlichen Natur
in Christus (Duophysitismus) nicht bildhaft wiedergegeben werden
könne, und sie erhoben gegen die Maler den entscheidenden
Vorwurf
(can.252):
"Ein solcher ,Linksmaler' hat ein Bild (eikon) gemacht, es Christus
genannt. Und dieser, Christus' ist göttlicher und menschlicher
Natur?
Und im übrigen hat er entweder nach dem Gutdünken
seines
vergeblichen Trachtens das Unumschreibbare der Gottheit mit der
Umschreibbarkeit des geschaffenen Fleisches zusammen umschrieben, oder
er hat jene unvermischte Einheit, damit der Widergesetzlichkeit der
Vermischung schuldig werdend, vermischt.
So hat er folglich zwei Blasphemien begangen - die der Umschreibung und
die der Vermischung.
Diesen beiden Blasphemien fällt nun auch derjenige anheim, der
das Bild mit Proskynese verehrt..."
"Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen im Geiste
und in der Wahrheit anbeten." [Joh 4,24]
Ferner:
"Niemand hat Gott je gesehen" [Joh 1,18] und
"Ihr habt weder seine Stimme gehört, noch seine Gestalt
(eidos)
gesehen " [Joh 5,37] und die Schrift preist alle selig, die da glauben,
obwohl sie ihn nicht sehen. [Joh 20,29]
Auch im Alten Testament hat Gott zu Moses und dem Volk gesprochen:
"Du sollst dir
kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgend etwas am Himmel
droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde"[Ex 20,4] denn
auf dem Berg (Sinai) "sprach (der Herr) zu euch mitten aus dem Feuer"[Deut 4,12]
, doch "ihr habt weder seine Stimme gehört, noch seine Gestalt
je gesehen."[Joh
5,37]
"Sie dienen einem Abbild und
Schatten der himmlischen Dinge"[Hebr 8.5]
und wiederum: "Auch wenn wir früher Christus nach menschlichen
Maßstäben eingeschätzt haben, jetzt
schätzen wir
ihn halt nicht mehr so ein"[2.
Kor 5,16],
"denn als Glaubende gehen wir unseren Weg, nicht als Schauende."[2. Kor 5,7]
Schliesslich hat derselbe (Paulus) beweiskräftig gesprochen:
"So gründet der Glaube in der Botschaft, die Botschaft im Wort Christi."[Rm 10,17]
Religiöse Bilder aller Art wurden zerstört, in den Kirchen die vorhandenen Dekorationen entfernt und durch bildlose Dekorationen abgelöst. Unter Kappadokiens Höhlenkirchen sind nicht wenige aus der Zeit des Bilderkampfes erhalten und zeigen die bildlose Malerei der Ikonoklasten, allen voran die Barbarakirche in Göreme. Unter dem etwas gemäßigteren Kaiser Leon IV. (775-780) waren die Auseinandersetzungen mehr dogmatischer Art. Nach seinem Tod berief seine bilderfreundliche Witwe, Kaiserin Eirene, nach mühsamem Zurückdrängen der auf Mönchsfeindlichkeit eingeschworenen Armee gemeinsam mit dem späteren Patriarchen Nikephoros 787 zu einer Synode in der altehrwürdigen Konzilsstadt Nicäa, in der die Bilder rehabilitiert wurden.
"Wir verlangen eindeutig und ausdrücklich, daß die ehrwürdigen und heiligen Ikonen ausgestellt werden wie das Bild des ehrwürdigen und heilbringenden Kreuzes selbst..."
Die Bilderfreunde (/Ikonodoulen) trafen sich. Auf diesem 7. allgemeinen Konzil wurde die inzwischen erarbeitete Bildertheorie des arabischen Mönches Johannes von Damaskus (ca. 650-750) zur Basis einer Theologie der Ikonen.
Die Bilderfeinde kannten die Positionen des wortgewaltigen Mönches aus Damaskus, er ist ihr Hauptgegner, ihn trifft ihr Bannfluch am heftigsten.
Johannes war
bereits gestorben, konnte seine Positionen nicht selbst vertreten.
Theodor, Abt des Studion-Klosters in Konstantinopel, wurde der
Wortführer auf dem Konzil und betonte die Ideen des Johannes
durch
eigene Vertiefungen. Johannes entkräftete zunächst
die
Bezugnahme auf das Alte Testament mit den Hinweisen,
- dass auf Gottes Geheiß an der Bundeslade
Bilder angebracht worden sind (Ex 25,18-22; Hebr 9,5)
- ebenso auf dem Vorhang des Tempels (Ex 26,31 und
36,8).
Das Hauptargument für Johannes von Damaskus war die Menschwerdung. Christus könne nicht durch Symbole, sondern nur durch seine menschliche Gestalt dargestellt werden. Seine Darstellung könne sein ewiges Bild im Sinne einer höheren Wahrheit spiegeln. Christus sei freiwillig Mensch geworden, deshalb sei es weder unmöglich noch respektlos, seine menschliche Gestalt abzubilden.
Die Inkarnation war das Hauptargument für die Rechtfertigung einer religiösen Bildkunst. Gottvater könne und dürfe aus diesem Grund allerdings nicht abgebildet werden. Johannes gibt den Bilderfeinden unumwunden zu, daß die nicht sichtbaren Glaubenswahrheiten auch nicht bildhaft dargestellt werden könnten. Aber: Alle seine Zeitgenossen hätten den historischen Jesus als Menschen gesehen, einige hätten aber glaubend seine nicht sichtbare Göttlichkeit erkannt. In seiner Verteidigungsrede für die Bilder argumentiert er:
"Ein Bild ist wirklich ein Abbild und Beispiel, ein Abdruck eines in ihm gezeigten Abgebildeten...
... daher habe ich den Mut, vom unsichtbaren Gott ein Bild anzufertigen, nicht als Unsichtbaren, sondern als um unsretwillen durch die Anteilnahme an Fleisch und Blut sichtbar gewordenen. So bilde ich nicht die unsichtbare Gottheit ab, sondern das Fleisch Gottes, das gesehen worden ist.
Wenn es schon unmöglich ist, die Seele abzubilden, wieviel mehr erst Gott, der auch der Seele das Nichtmaterielle verliehen hat..."
Interessant ist
ein Blick auf die historische und topographische Konstellation: Um in
einer bedrohlichen Phase der islamischen Angriffe die bilderfeindlichen
Provinzen ans Reich zu ketten und um sie nicht in die Arme des Kalifen
zu treiben, der ihnen problemlos Religionsfreiheit hat in Aussicht
stellen können, war der syrische Kaiser Leon III. auf eine
reichsweite Bilderfeindlichkeit eingeschwenkt, was den Vorwurf der
islamischen Infiltration begründet.
Im Gegensatz dazu lebte und lehrte Johannes von Damaskus in einem
Kloster in Jerusalem, das seit 637 unter islamischer Herrschaft stand
und in dem die Christen ihren Ideen nachgehen konnten, ohne das
Eingreifen eines sie reglementierenden christlichen Kaisers
fürchten zu müssen. Die Freiheit zur Widerrede gegen
den
christlichen Kaiser und zur Verteidigung der Bilder konnte Johannes nur
im bilderlosen islamischen Kulturkreis genießen.
Später hatten die Mönche des Studion-Klosters in
Konstantinopel unter ihrem Igumen, dem Hl. Theodor viel
Überzeugungsarbeit zu leisten um das durch die Propaganda der
Bilderstürmer verdorbene Konstantinopel zu
überzeugen. Noch
einmal flammte die Terrorherrschaft der bilderfeindlichen
Mächte
auf, die Mönche von Studion wurden 809 vertrieben und
verbannt,
konnten aber bald wieder zurückkehren. Noch 815 berief ein
bilderfeindlicher Kaiser ein ikonoklastisches Konzil in die Hagia
Sophia ein, ersetzte willkürlich den mutigen Patriarchen
Nikephoros und weitere 28 Jahre wurden Ikonen vernichtet und versucht
die Kirche mit dem Gewalt einer Schreckensherrschaft dem Diktat des
Kaisers zu unterwerfen. Klöster wurden geschlossen,
Mönche
terrorisiert, Ikonenmaler misshandelt; z.B. dem Mönch Lazarus
beide Hände im Feuer verbrannt.
Erst unter Kaiserin Theodora wurde 843 das Konzil von 787
bestätigt und am 11. März, dem 1. Fastensonntag,
verkündet. Die kaiserliche Macht erkannte endgültig
das Recht
der Kirche auf die selbstständige Regelung ihrer
religiösen
Angelegenheiten an.
Die Bildertheologie des Johannes wurde die Basis für die
Rechtfertigung des Bildergebrauchs und Entscheidungsgrundlage
für
die Konzilsväter. Die entscheidenden Passagen des
Konzilsbeschlusses von 787 lauten:
"... Die Verehrung des Bildes (eikon) geht nämlich auf das Urbild (prototypos) über, und wer das Bild verehrt, verehrt die Hypostasis dessen, was in ihm eingeschrieben ist.
Damit wird die Lehre unserer heiligen Väter bestätigt und gleichermaßen die Tradition der Katholischen Kirche, welche das Evangelium von einem Ende (der Welt) zum anderen aufgenommen hat. Somit folgen wir Paulus, der in Christo geredet hat, dem ganzen göttlichen Kreis, und den heiligen Vätern, indem wir die Überlieferungen bewahren, welche wir empfangen haben. So singen wir der Kirche prophetische Siegeshymnen:
'Juble, Tochter Zion! Jauchze, Israel! Freu dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Der Herr hat das Urteil gegen dich aufgehoben und deine Feinde zur Umkehr gezwungen. Der König Israels, der Herr, ist in deiner Mitte; du hast kein Unheil mehr zu fürchten.'
Und Friede wird über dir sein bis in ewige Zeit.
Wir ordnen an, daß diejenigen, die es wagen, etwas anderes zu denken oder zu lehren oder die gegen die offenkundigen Häretiker (gerichteten) kirchlichen Überlieferungen zu verwerfen oder irgendwelchen Zusatz hinzuzusinnen, oder etwas von den kirchlichen Weihegegenständen wegzuwerfen - ein Evangeliar, ein Kreuzzeichen, eine bildliche Darstellung oder eine heilige Märtyrerreliquie - oder ränkevoll und böswillig etwas hinzufügen, um einen Punkt der rechtskräftigen Überlieferung der katholischen Kirche umzustürzen, und zwar besonders, um die kirchlichen Kleinodien oder die frommen Klosterstiftungen zu verstaatlichen, wenn sie Bischöfe oder Kleriker sind, zu entfemen, Mönche und Laien aber von der Kommunion (koinonia) auszuschließen...
Das heilige Konzil akklamierte:
Wir alle glauben so, wir alle denken dasselbe, wir alle haben mit unserer Zustimmung unterschrieben.
Dies ist der Glaube der Apostel, dies ist der Glaube der Rechtgläubigen.
Dieser Glaube fundiert die Oikumene.
Im Glauben an den einen Gott, der in der Dreifaltigkeit besungen wird, küssen wir die verehrungswürdigen Ikonen.
Diejenigen, die es nicht so halten, sind verdammt ...
Diejenigen, die nicht so denken, sind weit aus der Kirche entfernt."
In den zwei entscheidenden Problemkreisen war ein Kompromiß gefunden:
Zum einen war das für die Bilderfrage
bisher unlösbare Dilemma des Duophysitismus nunmehr
lösbar:
Das Bild gibt zwar nur die menschliche Natur wieder, kann aber dennoch
akzeptiert werden, weil die nicht abbildbaren göttlichen
Anteile
dazu gewußt und ergänzend geglaubt werden. Der nicht
bildhaft sichtbare Glaubensakt drückt sich in den bekennenden
Inschriften aus. Das Göttliche erheischt eine Abbildung. Sie
gehört zu ihm wie der Schatten zu seinem Körper.
Im Umkehrschluß wäre ein Verbot der Bilder und ihrer
Verehrung eine Leugnung des sichtbar gewordenen Christus.
Theodor von Studion formulierte:
"Insofern Christus von einem unumschreibbaren Vater herkommt, kann er kein Kunstbild haben, weil er unbeschreibbar ist. In der Tat, welchem Bilde hätte die Gottheit, deren Darstellung in der Heiligen Schrift vollkommen verboten ist, gleichgestellt werden können? Insofern aber Christus von einer beschreibbaren Mutter geboren wurde, hat er natürlicherweise eine Darstellung, die dem mütterlichen Bilde entspricht. Und wenn er kein Kunstbild hätte, wäre er auch nicht von einer beschreibbaren Mutter geboren und hätte also nur eine Geburt - nämlich vom Vater. Dies aber wäre eine Umstürzung seines Heilsplanes."
Diese Überzeugung fand 843 Eingang in die Texte der Orthodoxie.
Zum anderen war entscheidend, daß die längst überfällige und letztlich konfliktauslösende Frage jetzt endlich ein für allemal geklärt wurde: Die vor den Ikonen vollzogene Verehrung und Kniefall (proskynesis) durch die Gläubigen gilt nicht den Holztafeln, sondern dem Urbild, geschieht nicht im Hinblick auf die Materie, sondern im Hinblick auf den Dargestellten. Die Wirkkraft des Abgebildeten ist immer im Bild. Es gibt eine Einheit von Urbild und Abbild nach Form und Ähnlichkeit. Die Anbetung (latreia) ist alleine Gott vorbehalten.
Der christliche Westen hat sich zunächst vehement für die Bilder ausgesprochen, z. B. der Diakon Epiphanius aus Catania.
Vergleiche der Ikone mit dem Andachtsbild westlicher Ausprägung machen die essentiellen Unterschiede deutlich:
Ziel der Ikone ist es, die heiligen Überzeugungen in allgemein verbindliche Bilder umzusetzen.
-
Ziel des Andachts-Bildes ist es, den Betrachter durch wie immer
geartete Gestaltungsmöglichkeiten möglichst
"andächtig"
zu machen, d. h. er soll an die illustrierten Geschehnisse erinnert
werden und emotional in sie eindringen bzw. an ihnen beteiligt sein.
Die Ikone basiert auf den Berichten glaubwürdiger Zeugen und auf den Richtigstellungen erleuchteter Konzilsväter.
-
Der Künstler, der ein Andachts-Bild malt, kann neue
Formulierungen zur Steigerung der Wirkung "cre-ieren".
Themenauswahl und Bildkomposition, Repräsentation der Einzelfiguren, Gestaltung der äußeren Erscheinungen der Ikone müssen die kanonischen Traditionen fortsetzen. Neu angefertigte Werkstücke müssen die Vorbilder der Vorlagen fortsetzen.
-
Der Künstler des Andachts-Bildes beweist seinen
Einfallsreichtum
und seine künstlerische Kreativität durch
ansprechende
Neuformulierungen des Themas.
Den Ikonenmaler bewegt eine mystische Teilhabe an der in Gebet und Schriftlesung geschauten verklärten Welt.
-
Der Künstler des Andachtsbildes bedient sich seiner Phantasie.
Die künstlerische Freiheit des
Ikonen-Schreibers ist in dem Satz der Heiligen Schrift zusammengefasst:
"Wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit." 2 Kor 3,17
-
"Künstlerische Freiheit" im durchaus weltlichen Sinne ist die
Grundlage des Gestaltungsprozesses für das Andachts-Bild des
Westens.
(Unter Verwendung der Auszüge die der Religionspaedagoge Horst Leps aus den Seiten 15 –20, 29, 51+52 unter Weglassung der Fußnoten, aber Ergänzung der Bibelstellen aus der Einleitung des Ausstellungskatalogs "Ikonen des Ostens - Kultbilder aus fünf Jahrhunderten", herausgegeben vom Erzbischöflichen Ordinariat Bamberg, St. Otto Verlag Bamberg, Copyright 1998 Erzbischöfliches Ordinariat Bamberg, Hauptabteilung Kunst und Kultur, Autor: Kurt Ruppert, Bamberg, erstellt hat)
2. Sonntag der grossen voroesterlichen FASTEN
Hl. GREGOR PALAMAS
| Lesung: Hebr. 1:10 - 2:3 EVANGELIUM: Mk. 2: 1 - 12 |
|
|
Hl.GREGOR
Palamas
Predigt
Erzbischof LEONID zum Fest
Es wird uns bewusst, dass Gott uns unser Heil nicht aufzwingt, sondern unser Mitwirken will. Mitwirken sollen wir nicht nur egoistisch an unserem eigenen Heil sondern auch alles dazu tun, um anderen die Heilung zu ermöglichen.
Diese menschliche Anstrengung zur Öffnung für die göttliche Energie führt zum Heilswirken in der "Syn-Ergie".
In der Fastenzeit sind wir aufgerufen dafür zu "trainieren".
Wege des Heils, die uns der Heilige GREGOR Palamas erschlossen hat.
Zunächst von der Gelehrsamkeit
des Ostens durch die
Erkenntnislehre des Dionysios Aeropagita fasziniert kam der
humanistisch gesinnte Mönch Barlaam in den Osten und stieg
bald
zum Hoftheologen des Kaiserhofes in Byzanz auf. Bald begann er die
Gebetspraktiken des Herzensgebetes der östlichen
Mönche zu
verspotten und zu bekämpfen.
Es ging den Mönchen den Zugang
zum ungeschaffenen Licht
Gottes,
das Erspüren der Energiewirkung Gottes, nicht als subjektive
Einbildung abtun und so verschütten zu lassen. Obwohl es ihm
zunächst nur Gefangennahme und Ausstoss aus der Kirche durch
einen
humanistischen Patriarchen einbrachte und er erst mehr als 5 Jahre
durch das Konzil von 1351 rehabilitiert wurde, setzte der Hl. GREGOR
Palamas die Unterscheidung zwischen dem unfassbaren Wesen Gottes und
Seinen erfahrbaren Energien durch.
Apophasis heisst Verneinung.
Apophatisch von Gott zu reden wird durch
den Versuch der Gotteserkenntnis durch menschliche Vernunft und
Welterfahrung ausgelöst. Es bedeutet, von Gott zu sagen, wie
Er
nicht ist: Er ist nicht begrenzt, nicht endlich, nicht
vergänglich
- also unbegrenzt, unendlich, unvergänglich u.s.w.
Dies ist die Absage an den
erkenntnistheoretischen "Realismus" der
westlichen Skolastik (Thomismus, Skotismus).
Demgegenüber bedeutet Kataphasis Bejahung, die positiv die Verkündung der Offenbarung Gottes ermöglicht, die Verkündung der Heilsereignisse Gottes, durch die Er in unsere Geschichte eingegangen ist und immer wieder in unser Schicksal eingeht und durch die Er sich uns in Seinen Energien zu erkennen gibt.
Die beiden Positionen dürfen
nicht fundamentlistisch
gegeneinander
gesetzt werden. Heilswichtig ist es hingegen die beiden Sichtweisen
stets gleichzeitig anzuwenden und damit nicht den
Trugschlüssen
der Begrenztheit menschlicher Vernunft zum Opfer zu fallen:
Wir
reden vom Wesen Gottes nicht anders als in Bildern und
Gleichnissen aber wir reden immer von heilswirksamer Realität,
wenn wir von Seiner Offenbarung und Seinen Heilsmysterien reden.
So wird Theologie zur geistlichen Medizin, derer die Menschheit unserer Zeit -gleichzeitig im Dilemma vom Wahn der "Allmachbarkeit" gefangen und gleichzeitig der absolut entwertenden Orientierungslosigkeit verfallen- im besonderen Maße bedarf.
Predigt
von
Erzbischof LEONID von Riga und Lettland
in der zweiten Woche der großen Fasten
*Quellenhinweis*
Christus lehrte in einem Haus das Volk. Über Ihn, den großen Wundertäter, hatte sich schon überall die Kunde verbreitet, und eine Menge Volks kam zu Ihm. Das Haus war so dicht umlagert, daß es unmöglich war, einzutreten und zu Jesus zu gelangen. Und siehe, vier Männer trugen einen Gichtbrüchigen herbei, der sich nicht selbst bewegen konnte, auch nicht die Kraft hatte, von seinem Bett aufzustehen. Sie wollten unbedingt zu Jesus gelangen, sie wollten mit Ihm zusammentreffen, um die Heilung des Kranken zu erbitten.
Die Hoffnung brannte im Herzen. Wenn man nur durchgehen könnte, wenn man Ihn nur sehen könnte . . . So stark war ihr Glaube an den Herrn, und so stark war die Hoffnung, daß Er dem Kranken helfen würde, daß kein Hindernis sie davon abhalten konnte. Sie kletterten auf das Dach des Hauses, öffneten die Decke und ließen von dort das Bett mit dem kranken Gichtbrüchigen zu Jesu Füßen herab. Als Jesus diesen Glauben der Männer sah, heilte Er den Gichtbrüchigen und vergab ihm seine Sünden, die offensichtlich die Ursache seiner Krankheit waren. Und der Kranke, der vorher nicht einmal die Möglichkeit hatte, sich zu bewegen, stand auf, nahm sein Bett und ging hinweg. Dadurch versetzte er alle, die sich daselbst befanden, in Erstaunen, so daß sie Gott um des großen Wunders willen verherrlichten.
Nicht ohne Absicht bietet uns die heilige Kirche diese Evangelienlesung in den Tagen der großen Fasten an, in den Tagen der Buße und des Gebetes um die Vergebung unserer Sünde. Auch unsere Seele gleicht dem Gichtbrüchigen aus dem Evangelium: Die Sünden ketten sie so an die Erde, daß sie sich selbst nur mit Mühe auf dem Weg des Guten bewegen kann. Allein die heilbringende Hilfe Gottes kann uns die Kraft geben, auf dem Weg der göttlichen Gerechtigkeit zu wandeln. Wie aber schüttelt man dieses Joch ab, das uns umgibt, und die uns bedrückenden irdischen Mühen, Sorgen und Bindungen, die uns vom Herrn abdrängen ? Wie kann es geschehen, daß wir Sünder, verdunkelt durch Makel und Leidenschaften, dieser Barmherzigkeit des Herrn, der umgeben ist von unzählbaren himmlischen Kräften und der Schar der Heiligen Gottes, für würdig befunden werden? Wie nähern wir uns diesem Licht und dieser Heiligkeit ? Das heute verkündete Evangelium zeigt uns den Weg. Seht, wie groß der Glaube des Kranken und derer war, die ihn hinzutrugen, wie stark war ihre Hoffnung auf Heilung! Sie überwandten alle Hindernisse und erlangten Heil.
So
auch wir - wenn lebendiger Glaube an den Herrn in uns glüht,
wenn
wir unverrückt auf Seine Barmherzigkeit hoffen und so fest
unsere
Heiligung begehren, daß wir alle Hindernisse, Anfechtungen
und
Versuchungen überwinden. Wo immer wir uns von dem entfernen,
was
uns zur Sünde zwingt und hinabzieht - wird auch uns nach
unserem
Glauben geschehen. Der Herr ist gütig und barmherzig, Er
erhört unsere inbrünstigen Gebete und
erfüllt unsere
innigsten Wünsche gnädig. Wie den
Gichtbrüchigen reinigt
Er uns von den Verfehlungen und hilft zu einem guten Leben in Christi
Nachfolge.
Amen.
Aus
STIMME der ORTHODOXIE
Zeitschrift der Berliner Diözese der Russischen Orthodoxen
Kirche (Patriarchat Moskau)
http://members.aol.com/StimmeOrth
o erbarmender Vater,
habe ich zerstreut.
Weit wandte ich mich ab von Dir
und ich kam in des Feindes Knechtschaft.
ob Deines masslosen Erbarmens
nimm mich auf, o Vater.
In leuchtenden Fasten,
erhellt durch der Gebete Lichtglanz,
lasst strahlend den Pflichten uns nachgehen,
damit wir entfliehen
dem Dunkel der Suende.
Heilige Dreiheit, wache
dass wir
die wir die Fasten schon drei Wochen durchlaufen,
unversehrt und unverurteilt
wuerdig sie weiter durcheilen
und Deine Gebote beachten.
3. Sonntag der grossen voroesterlichen FASTEN
KREUZVEREHRUNG
| Lesung: Hebr. 4:14 - 5:6 EVANGELIUM: Mk. 8:34 - 9:1 |
|
|
und Deine heilige Auferstehung verherrlichen wir !
In der Mitte der Fastenzeit verehren wir das Heilige, das lebenbringende und uns daher so kostbare Kreuz des Herrn. Nicht einem Stück Holz gilt die Verehrung sondern dem Herrn Selbst, dem Gekreuzigten und Auferstandenen !
denn wunderbar wurde das Feuer gelöscht durch das Holz des Kreuzes.
Der Stachel des Todes und der Sieg der Hölle ist zur Beute geworden.
Denn Du, mein Erretter, kamest und riefest denen im Hades zu:
"Lasset euch führen wiederum ins Paradies !"
Orthodoxe
Kreuzesverehrung
Das Leiden des Gottessohnes am Kreuz, das uns ermöglicht auch das Leid der Welt in diesem Licht zu sehen, führt uns im Glauben immer hin zur Auferstehung.
Zum Unterschied zum Westen, der beginnend mit der Aristoteles-Rezeption durch Augustinus und das Mittelalter weithin materielle und geistliche Welt streng trennt, lehrt und die Orthodoxie die Ganzheit der Schöpfung zu sehen, sei sie nun materiell oder nicht-materiell; und so auch die Ganzheit der Wirklichkeit: Kreuz und Auferstehung !
Wir kennen daher keine Konzentration auf die bloße Meditation der Leiden vor dem körperlichen Christusleichnahm auf Kruzifixen.
Unsere Verehrung des kostbaren und lebensspendenden Kreuzes ist eine dankbare Unterwerfung unter das Kreuz, das uns durch Gottes Menschenliebe vom Symbol der Hinrichtung zum Zeichen des Heils geworden ist.
Am fruehen Morgen
gehen wir zu Dir,
und preisen Dich in Hymnen,
Heiland der Welt,
da wir den Frieden gefunden in Deinem Kreuz,
durch das Du das Menschengeschlecht erneuert hast,
uns fuehrend zum abendlosen Licht.
Im Paradiese ward einst durch eines Baumes Frucht
das Vertrauen gebrochen und herbeigerufen der Tod.
Der Baum des Kreuzes aber
hat den Menschen das Kleid des Lebens gebracht.
Nicht mehr bewacht das Flammenschwert die Pforte von Eden.
Denn es nahte sich ihm eine neue Versoehnung,
des Kreuzes Baum.
Des Todes Stachel und des Hades Sieg ist zerschmettert.
Du tratest, mein Heiland, herzu,
den Bewohnern des Hades zurufend:
Lasst euch zurueckfuehren ins Paradies !
Heute tanzen der Engel Choere voller Freude,
Deinem Kreuze huldigend.
An ihm ja schlugst du Wunden der Daemonen Scharen,
an ihm wurdest, Christus,
Heiland Du den Menschen.
Sei gegruesst, dreimal seliges, heiliges Holz,
Kreuz,
Licht derer, die wandeln in Dunkelheit,
das du den vier Enden der Welt durch dein Leuchten zeigtest,
die Strahlen von Christi Erweckung,
wuerdige alle Glaeubigen,
das heilige Pas´cha zu schauen.
4. Sonntag der grossen voroesterlichen FASTEN
Hl. JOHANNES von der HIMMELSLEITER
|
Lesung: Hebr. 6: 13 - 20 EVANGELIUM: Mk. 9: 16 - 30 Durch Enthaltsamkeit konntest du die Kraft deiner Seele erneuern; sie mit himmlischer Herrlichkeit veredeln. Heiliger Moench JOHANNES Darum riefst du allen zu: Nichts ziehet Gottes Liebe vor ! |
|
Darauf
dürfen auch wir uns in der Fastenzeit vorbereiten.
"Während dein Leib durch die Enthaltsamkeit abnahm, konntest du die Kraft deiner Seele erneuern, sie mit himmlischer Herrlichkeit bereichern."
Aber die Kirche erläutert die Lehre des Hl. JOHANNES Klimakos richtig, wenn sie verkündet, dass Askese sinn- und wertlos ist, wenn sie nicht Ausdruck der Liebe ist. Und wieder in der Vesper zitiert sie den Heiligen mit den Worten:
"Darum riefst du allen zu: Gott habet lieb, und ewige Gnade werdet ihr finden.
Nichts ziehet Seiner Liebe vor!"
Aus: The Year of Grace, A Monk of the Eastern Church, A
Spiritual and Liturgical Commentary on the Calender of the Orthodox
Church, Crestwood N.Y. 1992, p125f.
Übersetzt durch *St.
Andreas Bote*
Wir sind eingeladen unser Vorleben zu kreuzigen um in der Auferstehung erloest und erneuert zu werden.
5. Sonntag der grossen voroesterlichen FASTEN
Hl. MARIA von Aegypten
| Lesung: Hebr. 9: 11 - 14 EVANGELIUM: Mk. 10: 32 - 45 |
|
|
Maria
wurde im noerdlichen Aegypten geboren und entfloh im Alter von 12
Jahren dem elterlichen Hause, um in der Weltstadt Alexandria ein Leben
der Ausschweifung zu fuehren, einzig die Befriedigung ihrer Lueste
suchend. Nach 17 Jahren ausschweifenden Lebens trieb sie die Neugier
mit Wallfahrern zum Fest der Kreuzerhoehung zu den Heiligen
Stätten in Jerusalem zu segeln. Auch auf dem Schiff und in
Jerusalem liess sie ihrer Leidenschaft freien Lauf und
verführte
jeden der es sich gefallen liess.
Als sie
zur Verehrung des heiligen Kreuzes inmitten des gewaltigen
Menschenstromes, welcher der Auferstehungsbasilika zuflutete, auch
selbst in die Kirche eintreten wollte, wurde sie an der Schwelle von
einer unsichtbaren Gewalt, die staerker war als sie, zurueckgehalten,
waehrend die uebrigen an ihr voruebergingen. Auch die vereinte Kraft
mehrerer Maenner, um deren Hilfe sie gebeten hatte, konnten sie nicht
ueber die Schwelle der Kirche bringen. Da kam es ihr ploetzlich
erschreckend zu Bewusstsein, dass ihr Suendenleben Ursache dafuer sei,
dass sie das Heiligtum in ihrem Zustand nicht betreten sollte. Zugleich
fiel ihr Blick auf die Ikone der allheiligen Gottesmutter im Vorraum
der Kirche. In Beschaemung und Reue rief sie die Mutter des Herrn an
und gelobte, jede Busse in ihrem zukuenftigen Leben auf sich zu nehmen,
wenn die Gottesmutter ihr Eingang in das Heiligtum und damit ein
Zeichen gewaehre, an dem sie erkennen werde, dass ihr goettlicher Sohn
ihr vergebe. Und - o Wunder - ungehindert konnte sie die Schwelle
uebertreten und mit den uebrigen Pilgern an der Verehrung des heiligen
Kreuzes teilnehmen. Hier traf sie der Strahl der Gnade. Einer
innerlichen Erleuchtung folgend, jenseits des Jordans Ruhe und Frieden
zu suchen, machte sie sich sofort auf den Weg und erreichte noch am
gleichen Tage die Kirche des Hl. Johannes am Jordan. Reumuetig
beichtete sie hier und empfing die Lossprechung und die Hl. Kommunion.
Sodann ueberschritt sie den Jordan, um weiter ostwaerts in der Wueste
Busse zu tun und die Wueste nicht mehr zu verlassen. Unter den
aeussersten Entbehrungen in Nahrung, Kleidung und Behausung reinigte
sich noch 17 Jahre ihr von ihren suendhaften Gewohnheiten und den
Verwuestungen der Leidenschaften.
Dann aber fand sie die verheissene Ruhe und den vollen Frieden in Gott, dem sie noch weitere 30 Jahre in der Wueste widmen durfte, durch wunderbare Erleuchtungen getroestet und gefuehrt zu den seligen Geheimnissen der Gottesschau. Erst in ihrem 77. Lebensjahr wagte sie es wieder, einem Mann zu begegnen, der zur Andacht in die Wueste gekommen war. Viele Moenche folgten naemlich der Praxis vom ersten Fastensonntag bis zum Palmsonntag ihr Kloster zu verlassen, um in Erinnerung an die vierzigtaegigen Fasten des Herrn in der Wueste ein Einsiedlerleben zu führen. Gottes Fuegung wollte es, dass der fast hundertjaehrige Priestermoench Sosima aus einem am Jordan gelegenen Kloster in dieselbe Einoede kam, in der auch Maria lebte. Da sie ihm , ohne ihn je gesehen zu haben, seinen Namen nennen konnte, erkannte er dass es Gottes Wille war, dass er ihr am Hohen Donnerstag vor der Auferstehung die Hl. Kommunion an den Jordan bringen sollte. Nachdem sie mit Leib und Blut des Herrn gestaerkt war, was sie so lange hatte entbehren muessen, bat sie den Priester Sosima, ihr auch im naechsten Jahr die Heiligen Gaben an die selbe Stelle zu bringen. Dann zog sie sich wieder in die Wueste zurueck. Sosima entsprach im darauffolgenden Jahr ihrem Wunsch, fand aber an der verabredeten Stelle den Leichnam der Heiligen, die ihren Namen vor ihrem Scheiden aus dieser Welt in den Sand geschrieben hatte. Der heilige Sosima bestattete sie an der gleichen Stelle, kehrte ins Kloster zurueck und verfasste hier vor seinem bald folgenden Tode zur Erbauung des spirituellen Lebens seiner Mitbrueder die Lebensgeschichte der Heiligen, wie er sie bei der ersten Begegnung aus ihrem Mund vernommen hatte. In ihrer heutigen Gestalt stammt der Bericht von Patriarch Sophronij von Jerusalem. (7. Jhdt.)
der Unumgrenzte vor aller Zeit,
liess leuchten dich -aus Aegypten Stammende- als ganz hellen Stern,
der Herr, der schon vor dem Geschehen alles erkennt.
Die durch die Angel des Fleisches viele gefangen,
fuer fluechtige Lust sie machte zur Beute des Teufels,
wurde wahrhaftig gefangen durch die goettliche Gnade des Heiligen Kreuzes,
Christi lebendigmachendes Zeichen.
Vormals von jeglicher Unreinheit erfuellt,
hast du dich durch Busse als Braut Christi erwiesen.
Du erstrebtest die Lebensweise der Engel,
ueberwandest die Daemonen mit der Waffe des Kreuzes.
Darum leuchtest du als Braut des Himmelreiches,
o vielgeruehmte Maria.
Uns, die in Liebe dein lichtbringendes und heiliges Gedaechtnis feiern,
sende Licht uns hernieder,
die du als Heilige jetzt bei Christus stehst, dem alles ueberstrahlenden Licht,
errette mich vor den vielfachen Stuermen des Lebens.

VERKUENDIGUNG
der
FROHEN BOTSCHAFT
an unsere allhl. Gebieterin, die Gottesgebaererin und stete Jungfrau Maria
| Heute ist der Anfang unserer Erlösung und die Offenbarung des Mysteriums von Ewigkeit. Der Sohn Gottes wird zum Sohn der Jungfrau, und Gabriel bringt das Evangelium der Gnade. Mit ihm rufen auch wir der Gottesgebärerin zu: Freue dich, du Gnadenerfüllte, der Herr ist mit dir ! |
|
Kanon
d.
Hl. JOHANNES MONACHOS
Predigt
des
Hl. GREGOR von NYSSA zum Fest
Seine Allheiligkeit, der
Ökumen. Patriarch BARTHOLOMAIOS: Bedeutung der Gottesmutter
Prof.
Larentzakis: Marienverehrung in der Orthodoxie
Prof.
Kallis:
"Blüte der Unversehrtheit" Prototyp der Neuen
Schöpfung
Mitten in der vorösterlichen Fastenzeit feiern wir die Inkarnation des urewigen Wortes.
Die Menschwerdung geschieht um der Erlösung willen, und die Erlösung durch Kreuz und Auferstehung setzt die Menschwerdung voraus.
Denn Gott wird Mensch, um uns Menschen zu vergöttlichen.
Das ist kein mechanischer oder magischer Vorgang.
Die freiwillige Menschwerdung des Sohnes und Wort Gottes im Schoße der Jungfrau ruft die Freiheit des Menschen auf, von sich aus, sich ohne vergewaltigt zu werden, dem Handeln Gottes zu öffnen und so das vergöttlichte Heil in sich geschehen zu lassen.
Dieses Heil besteht in der Vereinigung Gottes mit den Menschen und des Menschen mit Gott.
Dazu ist das freie "Ja" jedes Menschen unerlässlich, das "Ja", wie es die Gottesgebärerin nach gewissenhafter Überlegung gesagt hat:
" Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe nach Deinem Worte !"
Das Heil besteht aber nicht nur in der Erlösung des Menschen von der Sünde und allem Übel, sondern ebenso in der Wiederherstellung des Bildes Gottes, gemäss des ewigen Ebenbildes des Vaters in Jesus Christos, nach dem wir erschaffen wurden.


So
konnte
der Engel Maria die Botschaft der Freude
bringen.
Freude verkünden an
Weihnachten die
Heerscharen der Engel den Hirten.
Und der Auferstandene sagt den Aposteln und uns in Seinem
österlichen Gruß die Freude
zu.
So kann auch in der Fastenzeit die
Freude nicht untergehen:
Freude soll vielmehr auch die
Buße
leiten.
Daher ist dieses Freudenfest kein
Fremdkörper in der Fastenzeit; sondern gibt ihr Ausrichtung,
Tiefe und Glanz.
Das
Datum
des Festes wurde in Verbindung mit dem 25. Dezember gewählt;
es ist also
relativ spät festgelegt worden.
Nach älterem syrischen und gallikanischem Ritus wurde es an
einem der
Herrentage vor Weihnachten gefeiert.
Uns ist das Datum seit den Akten des Konzils von 692 bezeugt.
Wenn es auf den
Hohen Freitag oder Hohen Samstag vor Ostern
fällt, wird es bei
den Griechen auf den Ostertag verschoben und gemeinsam mit der
Auferstehung
gefeiert.
Dies ist gesetzt von Gott den Sterblichen,
spricht die Makellose,
dass gemeinsamer Liebe ein Kind
entstamme.
Doch ist mir gänzlich unbekannt die Lust der Vereinigung.
Wie kannst du behaupten, dass ich gebären werde?
Ich fürchte, du schwatzt mit Trug.
Aber gleichwohl, sprichst du:
Lobpreiset alle Werke des Herrn, den Herrn !
Der
Einwand,
welchen du aussprichst,
Ehrwürdige,
entgegnet wiederum der Engel,
trifft wohl zu bei den
gewöhnlichen Geburten sterblicher Menschen.
Der wahre Gott aber, künde ich dir,
nimmt Fleisch
an
aus dir, jede Vernunft und
jedes Begreifen übersteigend,
wie nur Er es
weiß.
Drum rufe ich mit Freuden:
Lobpreiset, alle Werke des Herrn, den Herrn !
Du
erscheinst als
Künder mir der
Wahrheit,
beendete dann die Jungfrau das Gespräch.
Denn als gemeinsamer Freude Bote bist du gekommen.
Da ich gereinigt wurde im Herzen durch den Geist,
geschehe mir nach
deinem Wort.
Wohnung nehmen soll in mir Gott,
zu dem ich mit dir rufe:
Lobpreiset, alle Werke des Herrn, den Herrn !
(
Kanon des JOHANNES Monachos (8. Jh.) zum Fest der Verkündigung
der Frohbotschaft an die Gottesmutter )
(Ausschnitt)
От Лука свето Евангелие
След тия дни зачена жена му Елисавета, и се таеше пет месеци и казваше:
тъй ми
стори Господ в дните, в които ме погледна милостно,
за да снеме от мене укора между човеците.
А на шестия месец бе изпратен от Бога Ангел Гавриил
в галилейския град, на име
Назарет,
при
една
девица, сгодена за мъж, на име Иосиф, от дома Давидов;
а името на девицата беше Мариам.
Ангелът влезе при нея и рече: радвай се, благодатна! Господ е с тебе;
благословена си ти между жените.
А тя, като го видя, смути се от думите му и размисляше, какъв ли е тоя
поздрав.
И рече й
Ангелът: не бой се, Мариам, понеже ти намери благодат
у Бога;
и ето, ти
ще заченеш в утробата, ще родиш Син и ще Го наречеш
с името Иисус.
Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния;
и ще Му даде Господ Бог престола
на отца Му Давида;
и ще
царува над дома Иаковов довеки,
и царството Му не ще има край.
А Мариам рече на Ангела:
как ще бъде това, когато аз мъж не познавам?
Ангелът й отговори и рече: Дух Светий ще слезе върху ти, и силата на
Всевишния
ще те осени; затова и Светото,
Което ще се роди от тебе, ще се
нарече Син Божий.
Ето и Елисавета, твоя сродница, наричана неплодна,
и тя зачена син в старините
си, и е вече в шестия месец;
защото у Бога няма да остане безсилна ни една дума.
Тогава Мариам рече: ето рабинята Господня;
нека ми бъде по думата ти.
И Ангелът си отиде от нея.
Die jungfräuliche Empfängnis - Gottes Schöpfertat
Gregor
von Nyssa (+ 394)
zum Fest Mariae Verkündigung
*Quellenhinweis*
In das Heilsgeheimnis wird die Jungfrau von Gabriel eingeweiht. Die Worte der Einweihung waren Segensworte: »Freue dich, Begnadete! Der Herr ist mit dir!« (Lk 1,28). Als Gegensatz zum ersten Spruch, der an eine Frau erging, ergeht nun dies Wort an die Jungfrau. jene wurde der Sünde wegen zur Betrübnis bei der Geburt verurteilt, bei dieser aber wird durch die Freude die Betrübnis aufgehoben. Bei jener ging Betrübnis der Geburt voran, hier aber war bei der Geburt Freude als Hebamme tätig! »Fürchte dich nicht!« (Lk 1,30), spricht er.
Da jeder Frau die Erwartung der Geburt Furcht bereitet, hebt die Verkündigung der freudvollen Geburt die Furcht auf. »Du wirst empfangen und einen Sohn gebären und sollst ihn Jesus nennen. Er wird sein Volk von den Sünden erlösen« (Lk 1,31). Was entgegnet Maria? Vernimm das Wort einer reinen Jungfrau! Der Engel verkündet ihr die Geburt, doch sie hält fest an der Jungfräulichkeit und misst der Unversehrtheit größeren Wert als der Erscheinung des Engels bei. Sie kann dem Engel weder den Glauben versagen, noch wird sie ihrem Entschluss untreu. »Mir ist der Umgang mit einem Mann versagt«, spricht sie. »Wie soll mir das geschehen?« (Lk 1,35) ...
Wenn Josef sie zur Ehe genommen hätte, wie konnte sie über die Botschaft des Engels befremdet sein, dass sie gebären werde? Denn nach dem Gesetz der Natur erwartete sie durchaus, auch einmal Mutter zu werden. Da aber ihr gottgeweihter Leib wie eine geheiligte Weihegabe unverletzt bewahrt werden musste, deshalb spricht sie: »Wenn du auch ein Engel bist und vom Himmel kommst und deine Erscheinung Über menschliche Erfahrung hinausgeht, so ist es doch unmöglich, dass ich einen Mann erkenne. Wie werde ich Mutter sein ohne einen Mann? Josef sehe ich als meinen Verlobten an, als Mann aber erkenne ich ihn nicht.«
Was erwidert Gabriel, der zur Jungfrau gesandt wird? Auf welches Brautgemach für die reine und unbefleckte Ehe weist er hin? »Heiliger Geist«, sagt er, »wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten« (Lk 1,35). Welch glückseliger Leib, der wegen seiner übergroßen Reinheit die guten Gaben für die Seele auf sich herabgezogen hat! Von allen anderen Menschen würde kaum eine reine Seele die Gegenwart des Heiligen Geistes in sich ertragen, hier aber wird der Leib zum Gefäß des Geistes. »Aber auch die Kraft des Höchsten wird dich überschatten«. Wie ist dieses geheimnisvolle Wort zu verstehen?
Homilie
auf Christi Geburt; PG 46, 1140B-1 141B, in: Heiser, Lothar, Jesus
Christus, Das Licht aus der Höhe, Verkündigung,
Glaube, Feier des Herren-Mysteriums in der Orthodoxen Kirche
(Schriftenreihe des Patristischen Zentrums Koinonia – Oriens;
Bd. 47), St. Ottilien 1998, S. 45f.
*aus St. Andreas Bote*
Kanon
des Johannes Monachos (8. Jh.)
zum Fest Mariae Verkündigung
Höre, Mädchen, reine
Jungfrau,
so kündete Gabriel den Ratschluss des Höchsten, uralt
und ohne Trug:
Sei zum Empfange Gottes bereit! Denn durch dich wendet der Unfassbare
sich wieder den Sterblichen zu.
Drum rufe ich mit Freuden:
Lobpreiset, alle Werke des Herrn, den Herrn !
Alles
Sinnen der
Sterblichen ist zu
schwach,
erwiderte die Jungfrau, zu ergründen, was Unbegreifliches du
mir kündest.
Ich freute mich deiner Worte, aber erschreckend fürchte ich,
dass du mit Täuschung mich wie Eva weit weg von Gott
führen willst.
Doch gleichwohl, sieh, sprichst du:
Lobpreiset, alle Werke des Herrn, den Herrn !
Sieh,
die
Verwirrung löst sich
dir,
entgegnete auf diesen Einwand Gabriel.
Denn mit Recht sagst du, der Plan sei unergründlich.
Folge nur den Worten deiner Lippen und zweifle nicht,
als sei er ein Truggebilde; dass Wirklichkeit er ist, das, glaube doch.
Denn auch ich rufe mit Freuden:
Lobpreiset, alle Werke des Herrn, den Herrn !
Dies
ist gesetzt
von Gott den
Sterblichen,
spricht die Makellose wiederum,
dass gemeinsamer Liebe ein Kind
entstamme.
Doch ist mir gänzlich fremd die Lust der Vereinigung.
Wie kannst du behaupten, dass ich gebären werde?
Ich fürchte, du schwatzt mit Trug.
Aber gleichwohl, schau, sprichst du:
Lobpreiset alle Werke des Herrn, den Herrn !
Der
Einwand,
welchen du aussprichst,
Ehrwürdige,
entgegnet wiederum der Engel,
trifft wohl zu bei den
gewöhnlichen Geburten sterblicher Menschen.
Der wahre Gott
aber, künde ich dir,
nimmt, jede Vernunft und jedes Begreifen
übersteigend,
Fleisch an, wie nur Er es weiß, aus
dir.
Drum rufe ich mit Freuden:
Lobpreiset, alle Werke des Herrn, den Herrn!
Du
erscheinst als
Künder mir der
Wahrheit,
beendete da die Jungfrau das Gespräch.
Denn als gemeinsamer Freude Bote bist du gekommen.
Da ich gereinigt wurde im Herzen durch den Geist,
geschehe mir nach
deinem Wort.
Wohnung nehmen soll in mir Gott,
zu dem ich mit dir rufe:
Lobpreiset, alle Werke des Herrn, den Herrn !
Kanon des
JOHANNES Monachos (8. Jh.)
zum Fest der Verkündigung der Frohbotschaft an die Gottesmutter
8. Ode, im Orthros des 25. März; Menaion
Linkhinweise zum Fest:
Wenn Englisch kein Problem ist und Acrobat Reader zur Verfügung steht,
dann sind alle Gottesdienste des Festes über folgenden Link zugänglich:
zu ->TRIODION gehen, dort das Fest auswählen:
Einführung: AnnuIntro
kleine Vesper: AnnuSV
grosse Vesper: AnnuGV
Morgendienst: AnnuMat
Göttl.Liturgie: AnnuDL
Polyelei: AnnuPol
Seine Allheiligkeit, der Ökumen. Patriarch BARTHOLOMAIOS:
Bedeutung der Gottesmutter in Konstantinopel
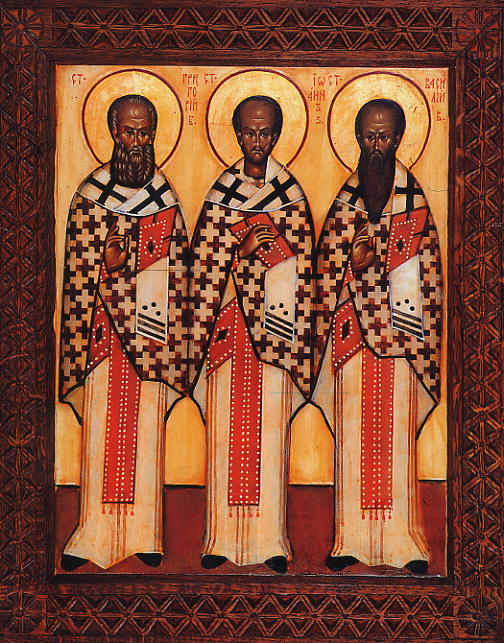

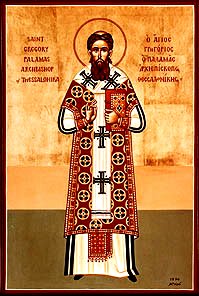

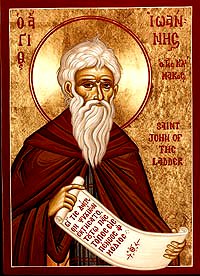
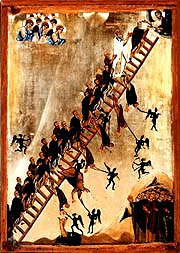

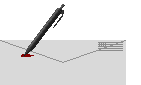 protostefan@gmx.at
protostefan@gmx.at