
Kloester

Orthodoxe Fraternitaet


|
Dreifaltigkeitskloster
|
Für denjenigen, dessen Augen geöffnet sind, ist
alles Irdische Bild und Gleichnis des Ewigen. Dies gilt in
vollendeter Weise für die geheiligte und mit Gott
geeinte Lebenswelt, die Kirche. Mit unseren
äußeren Sinnen und unserem rationalen Verstand
sind die ewigen geistigen Dinge zwar nennbar, aber nicht
faßbar. Deshalb galt für den alttestamentlichen
Menschen das Bilderverbot - denn es war den Menschen
schlechterdings unmöglich, Gottes Angesicht zu
schauen.
In Jesus Christus aber ist Gott selber Mensch
geworden. Dadurch hat Er uns von der Sünde
erlöst und vom ewigen Tod errettet. Überdies hat
er uns auf diese Weise ermöglicht, Ihn leibhaftig zu
sehen, anzuschauen, anzufassen; Er selbst hat uns in Seiner
Menschwerdung Sein göttliches Antlitz gezeigt. Seither
können wir in allen Christusikonen und in allen
Heiligen das Antlitz Gottes erkennen. Aber ebenso, wie man
die heilige Schrift nur im Heiligen Geiste wirklich
verstehen kann, so kann man auch nur im Heiligen Geist in
den irdischen Abbildern die ewige Wahrheit
wiedererkennen.
Weil nun Gott durch Seine Menschwerdung die ganze
Schöpfung erneuert und geheiligt hat, und uns Sein
heiliges Antlitz gezeigt hat ("wer mich sieht, sieht den
Vater", Joh.14,9), deshalb nutzen und ehren wir die
heiligen Bilder und Symbole im Kult. Wir unterscheiden aber
zwischen Anbetung (Latreia) und Verehrung (Proskynesis).
Anbetung gebührt einzig und allein Gott, der
wesenseinen und unteilbaren Dreiheit in Vater, Sohn und
Geist. Ehre aber gebührt jedem Heiligen, jedem Engel,
jedem heiligen Symbol, jedem Mönch oder Priester, jedem
orthodoxen Kultbild, kurz, allen authentischen
Manifestationen Gottes, Seiner Heiligen und Seiner
Kirche.
Die rituelle Ehrerweisung vor den heiligen Symbolen, dem
Evangelium, dem Kelch, den Ikonen, den geweihten Menschen,
dem Tempel usw. richtet sich stets auf Gott selbst und meint
letztlich immer Ihn - die konkreten Gegenstände oder
Personen aber insoweit, als sie Träger der
göttlichen Gnade und Kraft und
Gegenwärtigsetzungen der Herrschaft Gottes und Abbilder
Seiner Hoheit und Schönheit sind.
Das Ganze offenbart sich am Einzelnen, das Hohe im
Niedrigen, das unsichtbare Wesen in der sichtbaren Gestalt.
Das Antlitz eines Menschen z.B. zeigt nicht nur seine
augenblickliche Verfassung an, nicht nur das, was er gerne
darstellen möchte, sondern offenbart sein inneres Wesen
und seine ganze Geschichte. Freilich kann nicht jeder diese
Zeichen lesen.
Eine Ikone will uns nicht in erster Linie das
vergängliche irdische Fleisch des Dargestellten vor
Augen führen, sondern vielmehr das geistige, innere
Antlitz, die im Leben gewordene, nun ewige Gestalt
(Hypostase). Bei den Heiligen entspricht die im Leben
gewordene personale Gestalt (Hypostase) dem ewigen Urbild,
der göttlichen Idee dieses Menschen. Man könnte
von Jedem eine Ikone malen, aber solche Ikonen wären
nicht kultfähig, da nicht jeder ein Heiliger ist, seine
Gestalt ist noch unerfüllt, noch nicht in Wahrheit
verwirklicht.
Hier muß ich auf einen Unterschied eingehen. Eine Idee
im landläufigen Sinne ist eine menschliche Vorstellung
oder Wunschvorstellung von etwas oder von jemandem. Wenn
hier von der göttlichen Idee gesprochen wird, dann ist
damit ein Gedanke Gottes, ein göttliches Urbild
gemeint, dem schöpferische Macht innewohnt. Menschliche
Ideen sind aus der Anschauung der irdischen Gegebenheiten
gewonnen und können diese kreativ erweitern oder
verändern. Unsere irdische Lebenswelt ist wesentlich
von den menschlichen Ideen und Vorstellungen geprägt.
Göttliche Ideen aber haben keine Ursache, keine
Vorbilder, sondern bringen das Sein selbst hervor. Sie sind
selber die Urbilder des Seienden. Menschliche Abstraktionen
sind ebenfalls gedankliche Abbilder, verkürzte zumeist,
Denkfiguren, mit denen wir uns die Welt begreifbar machen -
aber sie sind etwas völlig anderes als die Gedanken
Gottes, von denen es heißt : "wer reicht an das
Maß Deiner Gedanken heran, wahrlich, sie sind mehr als
jede Zahl". Sowohl von den Gedanken Gottes als auch von
abstrakten Vorstellungen oder phantastischen Ideen sind die
schöpferische Ideen des Menschen zu unterscheiden. Wenn
nach ihnen Wirklichkeit gestaltet wird, dann ist es eine
Wirklichkeit, die in der Wahrheit ruht. Sie setzen Seiendes,
in der Ewigkeit verankertes, voraus, nämlich die
Gedanken Gottes, und also die Fähigkeit des Menschen zu
geistiger Schau. Insofern korrespondieren wahre
schöpferische Gedanken und Werke mit den Urbildern, den
Gedanken Gottes.
Wo menschliche Ideen ohne dem entstehen, entfernen sie sich
von der ewigen Wahrheit, anstatt sie abzubilden. Solche
unerleuchteten Ideen führen zu falschen Vorstellungen;
sie sind Pseudoikonen, geben keine wirklichen Urbilder
wieder, auch wenn sie aus Unwissenheit als Vorbilder
genommen werden. Wenn man ihnen nacheifert, nähert man
sich keineswegs der Wahrheit, sondern entfernt sich vom
Sein, verfällt in bloßes Dasein (Materialismus,
Ideologien usw.). Die moderne Unterhaltungsindustrie ist
voll von solchen Pseudoikonen. Sieht man die oft hysterische
Verehrung, die solchen Pseudoikonen widerfährt
(Popstars, Hitlers, Gurus), ermißt man den Trug, dem
Menschen ausgesetzt sind.
Ikonenmalerei kann nie "gegenstandslos" sein, da die Ikone
beansprucht, wahre ewige Wirklichkeit abzubilden. Aus
demselben Grunde kann sie nicht rein naturalistisch sein,
sondern wird sich immer irgendwo zwischen Abstraktion und
naturgetreuer Darstellung bewegen; dadurch bewahren die
Ikonen der verschiedensten Ecpochen immer eine gewisse
Eigenart, die sie vom Stil der weltlichen Malerei - ein
Stück weit - unterscheidet. Eine völlig abgehobene
bis ins Detail äußeren Festlegungen folgende
Ikonenmalerei ist hingegen nicht ideal.
Der Ikonenmaler muß versuchen, das ewige Urbild seines
Abbildes zu treffen. Er muß zunächst die
Gesamtheit der Entwicklung der Persönlichkeit des
dargestellten Heiligen zu erfassen trachten, um die in
Ewigkeit bleibende Identität und Wirklichkeit im Abbild
widergeben zu können. Diese Wesensgestalt nennt man
Hypostase. Nach christlicher nichtdogmatisierbarer
Auffassung werden wir nach dem jüngsten Tage unseren
Leib wiedererhalten, aber in einer Gestalt, die unserem
ewigen Wesen vollkommen entspricht - ohne Krankheit, ohne
Makel, ohne Alter usw. Diesem ist die Erkenntnis der
Wahrheit und die Erfahrung der göttlichen Liebe
eingeschrieben. Das ist die gnadenhafte Vollendung. Nur
wenige Ikonenmaler haben die asketische Schulung und die
geistige Schau, die Urbilder so klar zu erkennen. Deshalb
sind die Ikonentypen durch die kirchliche Tradition
vorgegeben, und das getreue Nachzeichnen ideal gemalter
Vorbild-Ikonen muß die unmittelbare Schau des Urbildes
ersetzen. So wird im Ganzen die nötige, ohnehin stets
nur relative, Übereinstimmung der Darstellung mit der
ewigen Wirklichkeit gewährleistet. Paul Florenski, ein
genialer orthodoxer Theologe, Priester und Martyrer unseres
Jahrhunderts, spricht von einer Arbeitsteilung : es gibt die
Schauenden, denen es gegeben ist, die kirchliche
ikonographische Tradition zu erweitern, und nennt dazu als
Beispiel den großen russischen Rublew; daneben braucht
es das Heer der Manufakturarbeiter, die die Abbilder der
authentischen Schau verbreiten. Keine gemalte Ikone kann
indes das eigentliche Wesen oder Sein (ousia) des
Dargestellten, noch seine derzeitige Beschaffenheit (physis)
ersetzen. Eine Ikone bleibt immer nur Holz und Farbe, so wie
die Verkündigung der Wahrheit stets aus menschlichen
Gedanken und Worten besteht, und kann deshalb niemals im
strengen Sinne identisch mit der ewigen Wesenheit sein. Die
wirkliche Gegenwart des Dargestellten wird dem
Gläubigen geistig und gnadenhaft zuteil, wenn er des
bedarf und geöffnet ist.
Ich muß nun den Begriff der Gestalt noch einmal
aufzugreifen und ihn in Beziehung zum "Wesen" setzen. Ich
habe Hypostase mit "Gestalt" übersetzt und den Begriff
inhaltlich präzisiert. Die Gestalt habe ich als "im
Leben gewordene" bezeichnet und daran die besondere
Qualifikation des Heiligen gegenüber dem noch nicht
vollendeten "Menschen" festgemacht. Hypostase wird aber auch
mitunter als "Erscheinung" übersetzt, was nicht falsch
ist. Man muß dazu nur wissen, daß die
"Erscheinung" einer personalen Wesenheit in der Gesamtheit
ihrer konkreten, Leben gewordenen Existenz gemeint ist. Dazu
gehört das Lebenswerk der Person, ihr Verhalten und
ihre Beziehungen zu anderen Menschen, zu Gott, zu den Engeln
und Heiligen, ihre Taten und Untaten, usw. Alles dies hat
natürlich sowohl mit dem innersten Wesen des Menschen
als auch mit der äußeren Person zu tun, und
muß doch von diesen unterschieden werden. Das Wesen
ist das zu Grunde liegende, vorkonkrete Sein, welches erst
und nur in der konkreten Lebenswirklichkeit ausgeprägte
Gestalt gewinnt, d.h. erst allmählich, im Laufe des
Lebens nach außen tritt, eben "erscheint"; daher
"Erscheinung". Das Wesen des Menschen birgt stets eine
Fülle konkreter Ausprägungsmöglichkeiten in
sich; durch die Auseinandersetzung mit der Welt, durch die
Erfahrungen des Lebens, durch Lernen, Wissen,
reflektierendes Erkennen, durch Leiden zuletzt und
Läuterung, zuinnerst durch Überwindung und
Hingabe, wird dann die konkrete Hypostase ausgeformt. Alle
Einflüsse, Prägungen und Erfahrungen aber werden
in einer spezifischen, nur diesem unwiederholbaren Menschen
eigenen Weise aufgenommen und verarbeitet, so daß
dieselbe Begegnung bei verschiedenen Menschen durchaus zu
sehr verschiedenen Empfindungen, Erinnerungen und
Prägungen führt. Das Wesen äußert sich
in der Bedeutung, sozusagen in Geschmack und Farbe oder
Klang, die die Dinge subjektiv annehmen. Der theologische
Terminus für das Wesen ist "ousia". Zum Wesen eines
Menschen, aber auch eines Engels, gehört der Gedanke
Gottes; dieser ist das ideale, ewige Urbild der betreffenden
Person. Ebenso gehört aber auch die Stofflichkeit zum
Wesen; bei uns ist dies Fleisch und Blut, irdische Materie -
die Engel sind von geistiger "Stofflichkeit", oder eben, wie
es in den liturgischen Texten heißt "körperlos,
unstofflich", was sich lediglich auf den Unterschied zu
unserer irdischen, fleischlichen Stofflichkeit bezieht, und
keine ontologische Definition sein will. Ebemso wie unsere
Körperlichkeit ist es aber unsere unsterbliche
Geistseele, die unser Wesen bildet.
Die Schöpfungsgeschichte beschreibt dies sehr
schön : " Gott nahm Lehm vom Acker und formte den
Menschen; und Er blies ihm den Odem des Lebens in seine
Nase. So ward der Mensch ein lebendiges Wesen". Materie und
Geist (Odem Gottes) bilden also den Menschen. Lebendig nennt
die Schrift uns, weil wir nicht nur irdischer Natur sind,
sondern auch unvergänglicher, geistiger Natur, weil wir
unsterbliche Seele sind. Die andere Stelle in der
Schöpfungsgeschichte in Genesis spricht vom Bild : "Und
Gott schuf den Menschen nach Seinem Bilde, zum Bilde Gottes
schuf Er ihn; und er schuf ihn als Mann und Frau". Die
zweifache Formulierung wird von den Vätern als Hinweis
auf eine zwiefache Bedeutung angesehen: zum Einen ist der
Mensch bereits durch seine Geschöpflichkeit Abbild
Gottes. Zum Anderen aber ist da ein Urbild, jener
göttliche Gedanke, welches erst noch im Leben
verwirklicht werden will.
Seit dem Sündenfall gehört Irrtum, Sünde,
Gottesferne zur real existierenden menschlichen Natur.
Krankheit, Leiden, Tod, Hinfälligkeit des Leibes sind
Abbilder und Folge der Beschädigung unserer geistigen
Natur. Ursache dafür ist die Sünde, die
Absonderung von Gott. Wenn wir sagen, dass Krankheit und Tod
die Frucht der Sünde sind, meinen wir das nicht in dem
Sinne, daß der Leidende selber sündig sei,
während der Gesunde für sich Heiligkeit und
Sündlosigkeit beanspruchen könnte, sondern
grundsätzlich auf die allgemeine irdische Existenz
bezogen.
Mit dem göttlichen Urbild tragen wir aber etwas in uns,
was zu unserem ureigensten Wesen gehört und was uns zur
Vollkommenheit, zur Reinheit und Schönheit streben
läßt.
Es ist der Irrtum, unsere geistige Hinfälligkeit, und
daraus folgend unsere Eigenliebe, Selbstsucht, Hochmut,
Habsucht, Gier, usw., die unser göttliches Urbild
verschmutzen, beschädigen und immer mehr
verschütten, bis wir zuletzt die Erinnerung daran
verloren haben. Das ist der gefallene Adam. Wir alle folgen
Vorbildern und werden von Vorstellungen und Prägungen
verschiedenster Art bestimmt - ohne uns in der Regel
Rechenschaft darüber abzulegen. Damit wird aber unsere
tatsächliche Lebensgestalt gebildet. Bewußt oder
unbewußt ahmen wir Menschen nach, die in unserem Leben
eine Rolle spielen; ebenso übernehmen wir Vorstellungen
und Verhaltensweisen, aber auch Ängste und
Unsicherheiten. Der äußere, ungeistige Mensch
orientiert sich dabei nach weltlichen Kriterien, wie Macht,
Erfolg, Reichtum, Ansehen usw. Alles dies gehört aber
noch zur unerlösten, gefallenen Welt. Wenn wir nun das
Prinzip erkennen, wird uns natürlich sehr
interessieren, inwieweit es möglich ist, uns von all
diesen weltlichen, zweifelhaften Vorbildern und
Prägungen zu befreien und unser eigenstes Wesen, jenes
göttliche Ubild in uns zu erkennen. Wenigstens wollen
wir an der Heranbildung unserer Persönlichkeit, d.h.
unserer im tatsächlichen Leben sich bildende, dann in
Ewigkeit bleibende Wesensgestalt, uns selber beteiligen. Wir
wollen darauf Einfluß nehmen, wie und durch was wir
unsere Wesensgestalt prägen lassen. Wir werden daher
unsere Lebenswirklichkeit in eine Richtung zu entwickeln
suchen, die unserem innersten, ewigen Wesen entspricht. Dies
wird uns in Harmonie mit der göttlichen Wahrheit
führen und uns unserer ewigen Bestimmung
näherbringen.
Nachdem Gott nun durch Moses und die Propheten und durch
vielfältige Zeichen, durch Heilige in allen
Völkern zu dem Menschen gesprochen hatte, und die
Menschen vorbereitet hatte, wurde er selber Mensch in Jesus
Christus. In ihm haben wir nun das Urbild des vollkommenen,
sündelosen Menschen und den lebendigen Gott selbst.
Christus kann die Vollkommenheit des göttlichen Bildes
sein, weil er selber Gott ist (während wir unserem
Urbilde niemals gleich, sondern nur ähnlich werden
können). Christus ist als "der neue Adam" das
vollkommene Bild Gottes. Indem wir nun im Kult der Kirche,
in den Mysterien, im Leben uns dieses vollkommene Bild
vergewärtigen und mit ihm kommunizieren, werden wir
auch unseres eigenen Urbildes wieder gewahr; es wird neu
belebt und erhält die geistige Nahrung, derer es
bedarf.
Es ist aber nicht mit dem Betrachten getan, auch nicht mit
der willentlichen Nachahmung (etwa im Sinne der "imitatio
Christi") oder dem Bemühen um einen asketischen oder
moralischen Lebenswandel allein. Erst wenn die
göttliche Gnade und Kraft durch die Sakramente und
Segnungen der Kirche uns berührt und erfüllt, erst
wenn wir das göttliche Leben wirklich in uns aufnehmen
und dadurch gewandelt werden, erst dann wird unsere
Erlösung wirklich; erst dann gewinnt unser
göttliches Urbild die gestaltende Macht, unsere
Lebenswirklichkeit und unsere Wesensgestalt zu durchlichten.
Dann erst können wir dem göttlichen Urbilde
wirklich ähnlich werden.
Umgekehrt ist aber der Empfang der Sakramente und die
äußere Zugehörigkeit zur Kirche keineswegs
ausreichend, sondern das Mühen um Heiligung und
Erkenntnis sind ebenso wichtig. Die Sakramente und Segnungen
der Kirche nähren, beleben und stärken unsere
geistige Natur; unser Mühen um Läuterung und
Heiligung (also der Bereich der Askese, des ethischen
Lebens) bereitet unsere irdische Natur zu. Dazu gehört
die Differenzierung und Läuterung unserer
Handlungsweisen, unserer Gefühlswelt und unseres
Bewußtseins (Reinigung der Gedanken). Das ist dann die
Grundlage für die eigentliche transzendierende
Wahrnehmung der Seele. Für diese asketisch-praktische
Seite des orthodoxen Weges wird man sich sinnvollerweise
einem geistlichen Vater (bzw. für die Frauen auch einer
geistlichen Mutter) anvertrauen.
Die göttliche Gnade und das Mühen des Menschen
können nicht gegeneinander ausgespielt werden; sie
bilden eine untrennbare Einheit. Dem aufrichtigen Mühen
des Menschen kommt die Gnade Gottes entgegen. Das
Zusammenwirken des Menschen mit Gott, des menschlichen
Mühens mit der göttlichen Gnade und Kraft, nennt
man Synergie.
Dieser ganze Zusammenhang findet sich als Kryptogramm in der
Weisheit Salomos, z.B. wo es heißt (soph. Sal. XI 17)
von der Hand Gottes, daß sie "die Welt aus
ungestaltetem Stoff ("amorfou hylés") erschaffen hat"
- Luther übersetzt "ungestaltetem Wesen", womit er den
inneren Sinn intuitiv erfaßte und wiedergab, der sich
auf den Ursprung des Seienden nicht im Sinne physikalischer
oder chemischer Beschaffenheit, sondern eben auf das in
Ewigkeit Bleibende bezieht, was jenseits des irdischen
Daseins, in demselben -oder trotz desselben- nach dem
göttlichen Urbilde und in der Synergie mit der
göttlichen Gnadenkraft an Wesensgestalt durch
Vollendung reift. Daß dies ein anderer, neuer
Schöpfungsvorgang ist, der indes als Telos bereits in
der Erstschöpfung angelegt ist, darüber sprach
Christus zu Nikodemus und seinen Jüngern
ausführlich.
Das göttliche Urbild eines Menschen zu erkennen, sei es
das eigene oder sei es das einer anderen Person, erfordert
nicht nur großes Wissen und Erfahrung, sondern auch
die Fähigkeit zu geistiger Schau. Wo dann die geistigen
Wirklichkeiten erkennbar werden, dort bedarf es zudem der
Gabe der "Unterscheidung der Geister". Diese
Fähigkeiten werden nicht ohne Leiden und nicht ohne
Opfer erworben. Sie gehören neben Demut, Klarheit,
Liebe und innerer Freiheit zu den Eigenschaften eines echten
geistlichen Vaters.
Kehren wir abschließend wieder zur Ikonenmalerei
zurück. Wir haben gesehen, welche Bedeutung das Urbild
und seine Verwirklichung für unser Leben haben. Wir
haben auch gesehen, daß es falsche Bilder und
Vorstellungen gibt, und daß es notwendig ist, falsche
von wirklichen Ikonen zu unterscheiden, wobei wir den
Begriff der Ikone auf das zugrundeliegene spirituelle
Prinzip hin erweitert haben. Dabei hatten wir zunächst
die Ikone eines Heiligen oder eines Engels, des Herrn oder
der allheiligen Mutter im Blick. Beim Malen einer
Festtagsikone gilt analog: der spirituelle Wesensgehalt des
Vorgangs, des Festes, muß erfaßt und
wiedergegeben werden; die historischen Umstände sind
für die geistige Schau zweitrangig. Bei der
Pfingstikone z.B. ist es nicht wichtig, daß die
Gebäude und das Mobiliar historisch richtig dargestellt
ist, sondern wichtig ist, daß das Feuer des Geistes
und die Bewegung und Haltung der Apostel angemessen
dargestellt werden. Es genügt ein angedeuteter
architektonischer Hintergrund, um zu zeigen, daß dies
in Jerusalem stattfand. Der Ewigkeit des Geschehens wird man
dadurch gerecht, daß man die Szene geradezu aus jedem
historischen Kontext entfernt; eine Übertragung in
andere Zeiten oder irgendwelche Aktualisierungen sind
völlig unangebracht. Die Typisierung der gemalten
Ikonen rührt zum einen von dem Beschränken auf die
ewige Aussage her, zum anderen gewährleistet sie,
daß jeder die Ikone auf den ersten Blick erkennt und
zuordnen kann; damit dient sie der Kommunizierbarkeit und
Verständlichkeit. Schließlich wird jede Ikone
beschriftet, um auch dem Unwissenden einen Anhaltspunkt zu
geben.
+


|
Dreifaltigkeitskloster
|
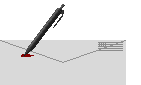
keine E-mail
Briefadresse:
Vater Abt JOHANNES
Deutsches Orthodoxes Dreifaltigkeitskloster
Buchhagen
D - 37619 Bodenwerder